Die Diskussion um das Thema Selbstorganisation hat mittlerweile den Mainstream erreicht. In den großen Wirtschaftsmagazinen taucht in diesem Zusammenhang immer wieder auch das Schlagwort Agilität auf und gleichzeitig sprießen aller Orten neue Organisationsmodelle wie zum Beispiel Holakratie, Adhockratie oder Tribe Cultures. Diesen Buzzwords ist gemein, dass sie nichts weniger als Kochrezepte für selbstorganisierte Teams und Organisationen bieten wollen.
Die Diskussion um das Thema Selbstorganisation hat mittlerweile den Mainstream erreicht. In den großen Wirtschaftsmagazinen taucht in diesem Zusammenhang immer wieder auch das Schlagwort „Agilität“ auf und gleichzeitig sprießen aller Orten neue Organisationsmodelle wie zum Beispiel Holakratie, Adhockratie oder Tribe Cultures. Diesen Buzzwords ist gemein, dass sie nichts weniger als Kochrezepte für selbstorganisierte Teams und Organisationen bieten wollen.
Aus der Sicht der Systemtheorie, gleich welcher Schule, ist das eine amüsante Angelegenheit. Denn es ist hinlänglich bekannt, dass alle komplexen Systeme stets selbstorganisiert sind. Es spielt dabei noch nicht einmal eine Rolle, ob man über soziale, biologische oder chemische Systeme spricht – ohne die Fähigkeit zur Selbstorganisation wären diese nicht in der Lage, sich als System zu konstituieren.
Natürlich sollte man in dieser Hinsicht nicht dem Irrglauben erliegen, dass man die Gesetzmäßigkeiten aus dem Bereich der Atome 1:1 auf soziale Systeme übertragen könnte. Dennoch sind gewisse Übereinstimmungen zu beobachten und eine einfache Einsicht lautet: Es besteht die zwingende Notwendigkeit zur Selbstorganisation. Sodass sich nicht die Frage stellt, ob diese sich selbst organisieren, sondern nur wie ihnen dies gelingt.
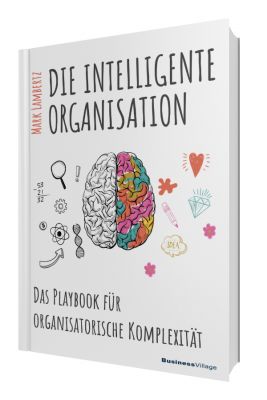
Damit kommen wir auch schon zum Kern meiner Kritik: Ich plädiere im sozialen Kontext dafür, auf das „Selbst“ im Begriff zu verzichten und sich lieber zu vergegenwärtigen, dass bereits heute Unternehmen, Organisationen und Institutionen selbstorganisiert funktionieren. Allein die Verwendung von hierarchisch anmutenden Organigrammen bedeutet noch lange nicht, dass sie es nicht wären. Es hat ja niemand den Menschen in den Systemen befohlen, starre, und zum Teil extrem kompliziert-detaillierte Hierarchien zu errichten. Die Verwendung des Kästchen-Denkens sagt insofern eher etwas über das allgemein praktizierte Verständnis von Organisation und Führung aus. Das bisher vorherrschende Paradigma des allwissenden Managements (Taylorismus), welches den Arbeiter wie ein Bauteil einer großen Maschine betrachtet, fällt langsam aber sicher in sich zusammen – es hat ausgedient, da es der Komplexität der heutigen Gesellschaft und des Wirtschaftens nicht mehr gerecht werden kann.
Somit ist der Ruf nach neuen Organisationsformen nachvollziehbar, doch historisch betrachtet nichts Neues. Bereits in den siebziger Jahren war die Rede von der lernenden oder flexiblen Organisation und es gab Versuche mit selbstorganisierten Fabriken in Jugoslawien. Heute bezeichnet man es bisweilen auch als agile Selbstorganisation, doch mich beschleicht der Verdacht, dass hinter diesen begrifflichen Moden eine ganz andere Debatte steckt: Die Frage nach der Mit- und Selbstbestimmung, die weit über reine Organisationsfragen hinausreicht ¬– es rüttelt am Menschenbild und wirft gesellschaftliche Fragen auf. Daher sei die folgende Frage zur Reflexion erlaubt: Wie sieht eigentlich Ihr Menschenbild aus? Überlegen Sie gerne einen Moment. Denn Ihre Antwort soll quasi die Grundlage Ihrer späteren Bewertung von Arbeitsgestaltungsmaßnahmen bilden.

Gelingende Selbstorganisation von sozialen Systemen verlangt nach Reflektions- und Lernräumen
Insofern überrascht es auch nicht, wenn die Einführung von agiler Führung und Organisation durch eine reine Methodenhörigkeit zum scheitern verurteilt ist. Denn oft genug findet ein sogenanntes Reframing von disziplinarischer Macht statt: Die Titel der organisatorischen Rollen werden zwar neu verteilt, und an der Oberfläche neue Rituale gespielt, doch die Führungskräfte „hijacken“ die neuen Verfahren mit ihren alten sozialen Prozessmustern. Das Ergebnis: Es bleibt alles beim Alten, und die Chancen eines besseren Umgangs mit Komplexität durch die Entfaltung des Humanpotentials bleibt ungenutzt, weil Mit- und Selbstbestimmung die bisherige Legitimation von Führungskräften in Frage stellt.
Es kursieren daher viele Mythen rund um die Fragen des partizipativen Managements. Es gleicht der Situation von Teenagern, die gerne Sex hätten: Alle reden drüber, man hat schon viel drüber gehört, aber keiner weiß wie es geht. Im Kontext der Selbstorganisation erwarten die einen paradiesische Zustände und nichts weniger als eine neue evolutionäre Stufe der Menschheit, währenddessen die anderen das pure Chaos befürchten, wenn mehr Mitspracherecht herrschen würde.
Im Zusammenhang der Selbstorganisation fällt dann zusätzlich der zuvor erwähnte Begriff der Agilität und die Abwehrreaktion ist reflexartig vorprogrammiert. Die Befürchtung: Jetzt reden noch mehr Leute mit und gleichzeitig sollen die Aufgaben schneller als zuvor erledigt werden? Wer kann das schaffen? Wie ist es möglich die erforderliche „Entscheidung-Handlungszeit“ (Decision Action Time) unter diesen Umständen herzustellen?
Nun bietet es sich an, erstmal die Begrifflichkeiten zu definieren und eine erste Näherung auf der Sachebene vorzunehmen. Um beim zuletzt benannten Begriff der Agilität zu bleiben, soll die Definition von Talcott Parsons herangezogen werden. Dieser interpretierte das Wort „Agil“ als Akronym:
A = Adaption, Anpassungsfähigkeit an die Umwelt,
G = Goal Seeking, Ziel suchend, das streben nach einem Ziel,
I = Inclusion/Integration, die Fähigkeit Zusammenhalt zu gewährleisten,
L = Latency, die Stabilität von Strukturen, welche Werte für die Umwelt erzeugen.
Damit wird hoffentlich deutlich, dass Agilität keinen Selbstzweck verfolgt, sondern eine zwingende Bedingung von lernenden Systemen darstellt. Mithin könnte man behaupten, dass bereits heutzutage Organisationen nicht nur selbstorganisiert, sondern auch agil und lernfähig sind. Wären sie es nicht, so wären sie nicht in der Lage ihre eigene Existenz aufrechtzuerhalten. Man stellt heutzutage beinahe verwundert fest, dass die bisherige Agilität plötzlich nicht mehr ausreicht, da die Veränderungen in der Umwelt in immer kürzeren Zyklen stattfinden. Der Druck aus der Umwelt ist zu groß.
Die Fähigkeit zur Erhöhung der eigenen Lernfähigkeit kann jedoch nicht durch vereinzelte Maßnahmen oder gar durch eine individuelle Entwicklung der Menschen erreicht werden. Noch verkehrter scheint es, wenn Menschen eine höhere Belastbarkeit (Resilienz) verordnet wird, damit diese mit „dem Stress“ besser umgehen lernen.
Aus systemischer Sicht ist es viel wirkungsvoller, sich zunächst den Strukturen und Paradigmen des Systems zuzuwenden, statt an einzelnen Parametern zu schrauben. Denn die Strukturen, Regeln und Glaubenssätze des Systems bestimmen den Möglichkeitsraum des sozialen Austauschs.
Wie aber sähe dann ein lernfähiger „Ordnungsrahmen“ aus? Wie müsste eine Landkarte der (Selbst-)Organisation beschaffen sein?
An dieser Stelle hilft es wiederum einen Blick in die Geschichte der Organisationstheorie zu werfen, um zu verstehen, welche grundsätzlichen Struktur- und Interaktionsmuster in jedem lernfähigen System vorzufinden sind. Der Verweis auf die Geschichte zielt das Viable System Model, welches der britische Management-Kybernetiker Stafford Beer erstmalig im Jahre 1959 formuliert hat.
Das Modell (VSM) bietet einen Blick auf die verschiedenen Funktionen (Subsysteme) lebensfähiger Organisationen einschließlich deren Beziehungen untereinander. Diese Modell-Brille erklärt sehr einfach, warum eine anpassungsfähige und teilautonome Organisation der Wertschöpfung einschließlich der entsprechenden Schnittstellen zum „Kunden“ gewährleistet sein muss (aka Kundenzentrierung). Ferner verweist das Modell auf eine Hierarchie, die sich aus dem Management-Kontext heraus ergibt und sich nicht mit der Logik eines Organigramms abbilden lässt. Diese Hierarchie dient dazu die Bindekräfte (Kohäsion) des Systems zu stärken und ist keineswegs im klassischen Sinne dazu gedacht einen Schuldigen ausfindig zu machen, wenn etwas schiefläuft.
Die Aspekte der Teilautonomie und der Zentralität eines lernfähigen Systems gilt es bestmöglich auszutarieren und „in Schwung“ zu halten, denn bei einer perfekten Balance hätten wir es mit harmonischen Systemen zu tun – und die sind, frei nach Peter Kruse, in der Regel dumm. Es wird somit deutlich, dass Lernfähigkeit immer einen Kompromiss aus lokaler Verantwortung seitens der Operation und zentralen Management-Strukturen bedeutet. Im Modell werden dabei folgende Einheiten beschrieben, um diesen Kompromiss besser zu verstehen:
System 1: Die Operation des Gesamtsystems, dieses liefert Werte für die Umgebung und bestimmt den Zweck des Systems. Es gilt zu erkennen was die Organisation ‚wirklich’ leistet und benötigt, damit die Wertschöpfung den Zweck erfüllen kann.
System 2: Die Koordination der Standardaufgaben des Gesamtsystems, insbesondere die teilautonome Planung des Tagesgeschäfts. Es arbeitet innerhalb definierter Grenzwerte (von/bis). Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem System 1. Zudem werden hier die Kennzahlen der operativen Einheiten aufbereitet und dem nächsten System zur Verfügung gestellt.
System 3: Ist dafür verantwortlich, die ohnehin stattfindende (Selbst-)Organisation der operativen Einheiten zu optimieren und Synergien zwischen diesen herzustellen – maßgeblich im „Innen & Jetzt“. Dies ist die erste Management-Ebene des Modells und wirkt im taktischen Sinne. Außerdem verteilt das System 3 die Ressourcen an die 1er-Systeme.
System 3*: Sorgt für die Beseitigung von Anomalien, welche die Lebensfähigkeit des Systems bedrohen. Dieses Subsystem wird auch als Audit-Kanal bezeichnet, da es dazu dient, systemische Fehler zu finden und mithilfe des System 1 aufzulösen. Im Idealfall wird es als Befähigungs-Kanal genutzt und ist Teil der Lernkultur.
System 4: Beobachtet die Umgebung und ist für längerfristige Handlungsräume ausgelegt. Daher kann man es auch die strategische Managementebene nennen, in der alle mit der Zukunft betrauten Themen behandelt werden. Das System liefert Szenarien, Hypothesen oder Prototypen und ist damit für das „Außen & Dann“ zuständig.
System 5: Die ultimative Autorität einer lebensfähigen Organisation, welche verschiedene Aufgaben für das Gesamtsystem übernimmt. Zuvorderst sei die Verantwortung für die Identität, Vision und die Werte genannt. Es repräsentiert das Ethos des Systems und bestimmt die „soziale Atmosphäre“. Als letzte Management-Ebene sorgt es für die Normen und erzeugt den übergreifenden Handlungsrahmen. Wichtig: Es zählen nur die „realen“ Interaktionen und keine wohlfeilen Sätze aus Hochglanzbroschüren. Zusätzlich muss es dauernd die Interessen des „Innen & Jetzt“ mit dem „Außen & Dann“ ausgleichen und gibt damit auf lenkende Art den groben Kurs der Organisation vor.
Eine erweiterte Darstellung des Viable System Model nach Stafford Beer stellt sich folgendermaßen dar:

Mit diesem Exkurs ist hoffentlich deutlich geworden, dass gelingende (Selbst-)Organisation immer nach Mit- und Selbstbestimmung verlangt, um die Entscheidungsfähigkeit an dem Ort, von jenem Menschen, mit diesen Problemen am besten zu entwickeln. Nur so ist es möglich, mit der allgegenwärtigen Komplexität umzugehen und von dieser zu profitieren – immer im jeweiligen Kontext, in dem diese auftritt und bewältigt werden muss.
Zusätzlich vermittelt das VSM einen weiteren Baustein für gelingende Organisation: Gemeinsame Werte und eine gemeinsame Vision von einem übergeordneten Ziel, welches dabei hilft die Akteure des Systems sich aufeinander auszurichten zu lassen (wie der Nordstern auf einer Landkarte). Es schafft die Rahmenbedingungen für soziales Verhalten und bestimmt den Möglichkeits- und Lernraum raum im normativen Sinne. Davon ist natürlich der Umgang mit Autorität betroffen. Gemeinsame Werte erlauben es jedoch, dass natürliche, kompetenzbasierte Interaktionsmuster entstehen können. Wenn man den entsprechenden Freiraum zulässt, dann operieren diese Wert-Kompetenz-Strukturen als höchst effektive Komplexitätsreduzierer und schaffen ein „Wir“. Endlich kann man sich um die „wirklichen“ Probleme kümmern und verheddert sich nicht mehr so oft im menschlichen Miteinander. Solche Wert-Strukturen sind daher ein ökonomisches Erfolgskriterium und keine pure Sozialromantik.
Werte können aber nicht direkt beeinflusst werden und die Vorgabe eines Leitbildes durch ein vom Maschinenraum entkoppeltes Management wirkt eher kontraproduktiv. Wer sich aber auf den Pfad des partizipativen Managements begibt und die Entwicklung von Werten als kollaborativen Prozess begreift, hat beste Aussichten die Organisation lebensfähig zu gestalten und den geringsten Schaden für Menschen und Kosten zu bewirken. Dazu gehört Widerspruch und konstruktiver Ungehorsam, weil nur die Vielfalt der Perspektiven es ermöglicht, eine komplexe Situation besser zu beurteilen und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Denn darum geht es im Kern von (Selbst-)Organisation: Die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit eines Systems ganzheitlich entwickeln, um die Ziele des Systems zu erreichen. Das ist ein kollektiver Lernprozess.

Mark Lambertz tanzt mit der Komplexität. Mit seiner detaillierten Neubearbeitung macht er das Viable System Model in der Praxis anwendbar und Komplexität steuerbar. Sein neuartiger Ansatz besinnt sich auf den Kern der lebensfähigen Organisation: Er legt die Komplexität von Organisationen offen, hilft Probleme zu identifizieren und endgültig aufzulösen. Als Berater, Speaker und Fachautor ist er eine feste Größe in der Szene.

