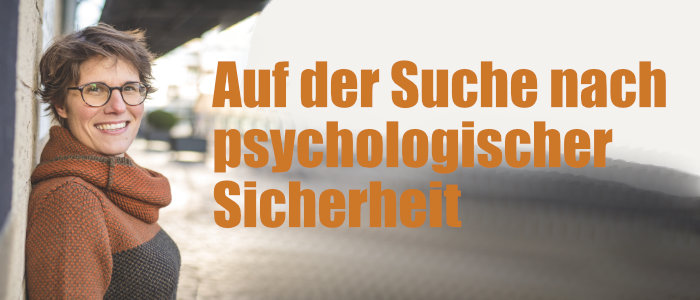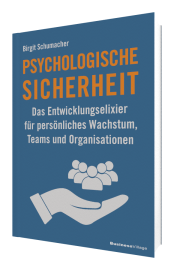Wie werden Teams mutig und innovativ? Durch Vertrauen. Es ist die Basis für psychologische Sicherheit. Unsere Autorin Birgit Schumacher illustriert die neurobiologischen Mechanismen hinter der psychologischen Sicherheit. Denn ihr Verständnis ist essenziell, wenn wir ein Umfeld psychologischer Sicherheit schaffen wollen.
Unser Nervensystem ist so aufgebaut, dass es über Rezeptoren ununterbrochen und ganz automatisch die Umgebung nach Gefahren absucht. Es will damit unser Überleben schützen.
Heute ist es weniger der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und unser Leben bedroht. Im einundzwanzigsten Jahrhundert kann es viel mehr ein Auto sein, das aus einer Seitenstraße geschossen kommt. Nicht so unmittelbar wie das Auto, aber genauso bedrohlich kann eine Gruppe von Menschen auf mich wirken, mit denen ich zusammenarbeiten soll, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie mich mit meiner Art akzeptieren. Die Gefahr, abgelehnt zu werden, wirkt heute wie gestern als starke Bedrohung auf uns. Das bedeutet, dass wir ständig unser Außen bewerten und darauf in Millisekunden reagieren. Dabei ist es egal, ob das, was wir sehen, wirklich eine Tatsache ist oder nur eine Vorstellung in unserem Kopf.
Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wenn du im Wald spazieren gehst und meinst, einen Bären zu sehen, wird automatisch dein autonomes Nervensystem anspringen und dein Körper wird entsprechend reagieren. Du wirst merken, wie dein Puls schneller geht. Vielleicht wirst du förmlich vor Angst erstarren oder du wirst schneller, als du je gelaufen bist, vor dem Bären davonrennen. Völlig unabhängig davon, ob der Bär wirklich dort steht oder ob es eine Sinnestäuschung war. Entscheidend bei der Reaktion ist deine Bewertung der äußeren Situation.
Neurobiologisch könnte man es wie folgt beschreiben: Zwischen deinem Außen und dem, was du daraus machst, wie du es interpretierst, ist eine Art Filter eingebaut. Dieser Filter nimmt alle Informationen aus der Umgebung auf und sammelt sie. Sicherheit entsteht dann, wenn dieser Filter das Ergebnis ableitet, dass keine Gefahr droht oder besteht.
Der Filter setzt sich aus vier Ebenen der Wahrnehmung zusammen:
- Exterozeption: die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen.
- Interozeption: die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen.
- Propriozeption: die Fähigkeit, die Lage des Körpers im Raum wahrzunehmen.
- Neurozeption: die Gesamtheit von Innen und Außen.
Wie sensibel unser System reagiert, wird maßgeblich davon beeinflusst, was wir im Laufe unseres Lebens über Gefahr und Sicherheit gelernt haben. Insbesondere, wie viel Stress wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Deshalb sollten wir uns oder andere Menschen auch nicht abwerten, wenn wir ängstlich oder unsicher sind. Was für den einen noch sicher ist, fühlt sich für den anderen unsicher an. Und beides ist im Sinne der jeweiligen Neurozeption wahr und richtig.
Sicherheit ist ein subjektives Erleben
Die Interozeption, Exterozeption und Neurozeption eines Menschen entwickeln sich bereits im Mutterleib und sie bilden sich im Laufe der Kindheit weiter aus.
Wie oben beschrieben hilft uns unser Frühwarnsystem, zu erkennen, wann etwas gefährlich ist und wann nicht. Dafür muss dieses System mit Informationen darüber versorgt werden, was sicher, was bedrohlich und was lebensbedrohlich ist. Dies geschieht im Kindesalter. Hier schon wird unser Frühwarnsystem programmiert. Durch eigene Erfahrung und die – im besten Fall – gute Begleitung der verantwortlichen Erwachsenen oder durch das Abgucken des Verhaltens bei ebendiesen.
Um es noch etwas konkreter zu machen: Kinder, die in einem bedrohlichen Umfeld aufwachsen, entwickeln eine Exterozeption, die angespannt und übersteuert ist. Die Exterozeption von Kindern, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen, reagiert hingegen entspannt aufmerksam.
Es gibt also Menschen, die überall Gefahren sehen und den Teufel an die Wand malen, und Menschen, die entspannter mit dem umgehen können, was sie im Außen vorfinden. Sie entscheiden sich dabei nicht aktiv für ihre Bewertung, es ist ein automatischer Prozess, der in ihrem Innern abläuft. Diesen Prozess kann man jedoch beeinflussen und daran arbeiten – dazu wirst du im zweiten und im letzten Kapitel mehr Informationen finden.
»Psychologische Sicherheit ist
immer ein subjektives Empfinden.«
Eine Interozeption, die die inneren Wahrnehmungen schnell als bedrohlich einstuft, entsteht, wenn Kinder früh mit körperlichem Schmerz oder einer Krankheit konfrontiert werden. Hier werden körperliche Symptome früh und stark wahrgenommen. Dadurch können Ängste entstehen, die das weitere Verhalten bestimmen. Wenn Kinder die Welt als gefährlichen und lieblosen Ort kennenlernen mussten, wenig körperliche Berührung bekamen oder Bezugspersonen ausgesetzt waren, die ein schädigendes Verhalten auf das Kind hatten, entwickelt sich daraus eine Neurozeption, die beständig Gefahr meldet.
Bis hierhin lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen, die für das weitere Verständnis wichtig sind:
- Die Basis für das, was wir grundsätzlich als sicher empfinden, basiert auf den Erfahrungen unserer frühen Kindheit.
- Da wir immer auf der Suche nach Sicherheit sind, ist unser Verhalten darauf ausgerichtet. Wir machen nichts, was für uns gefährlich sein könnte.
Diese Zusammenhänge erklären, weshalb verschiedene Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich sicher fühlen oder warum bestimmte Menschen mit Veränderungen besser klarkommen als andere. Das gilt auch und gerade für das Verhalten in Beruf und Arbeitsleben.
Woran kann man das Gefühl von Sicherheit messen?
Der Zustand von Sicherheit und Unsicherheit ist neurobiologisch abbildbar. Dafür hat der amerikanische Psychologe und Achtsamkeitsforscher Daniel Siegel das Stresstoleranzfenster beschrieben (»Window of tolerance«). Es dient als Modell für die einfache Veranschaulichung unseres Nervensystems: Es meldet uns entweder Sicherheit oder Gefahr.
Wir erinnern uns: Ein Mangel an (empfundener) Sicherheit führt zu Stress. Die Stressreaktionen geben uns Auskunft darüber, wo wir uns in unserem Toleranzfenster aufhalten.

Es gib drei Bereiche des Erregungsniveaus:
- Den Bereich des optimalen Erregungsniveaus: dort, wo wir uns sicher fühlen.
- Den Bereich der Übererregung unter Unsicherheit. In diesem Zustand ist unsere Wahrnehmung stark geweitet. Wir stehen unter Anspannung, sind gestresst und nehmen unser Außen als bedrohlich wahr. Unsere Exterozeption steht förmlich unter Feuer. Beispielhafte Symptome der Übererregung können sein: innere Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, körperliche Unruhe, Schlaflosigkeit, Gedankenkarussell, Reizbarkeit, Wut.
- Den Bereich der Untererregung unter Unsicherheit: Wir nehmen weniger von unserem Außen wahr. Auch die Interozeption ist abgeschwächt. Symptome der Untererregung können sein: wenig Ausdruck in Mimik und Gestik, leere im Kopf, Verlust von Konzept und Zusammenhang, Schwierigkeiten, Entscheidungen und Planungen umzusetzen, Rückzug, Vermeidung sozialer Kontakte, Gleichgültigkeit, Verlust von Motivation.
Wenn wir also ein Umfeld psychologischer Sicherheit erschaffen wollen, ist es wichtig, diesen Zusammenhang bewusst vor Augen zu haben. Das umgebende System sollte so sicher sein, dass jeder innerhalb seines Stresstoleranzfensters agieren kann – unabhängig davon, wie weit es ausgeprägt ist. Wir sollten immer die Erwartung haben, dass Menschen sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben und sich unterschiedlich verhalten. Ein solches für eine Gruppe von Menschen passendes Umfeld können wir nicht allein erzeugen, es ist eine Aufgabe, die besser gemeinsam mit dem Team angegangen werden sollte. Führende sollten nicht in die Falle laufen, dass sie sich allein für die Herstellung psychologischer Sicherheit verantwortlich fühlen.
Und wie schaffen wir ein pschologisch sicheres Umfeld?
Wir haben bis hierhin gelernt, was mit uns passiert, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Das heißt, wie und wann unser Nervensystem Gefahr meldet. Gefahren waren früher ein Säbelzahntiger, heute wird eine Konfliktsituation als existenzielle Bedrohung durch das Unbewusste gewertet. Beides versetzt unseren Körper in eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne. Wir werden dann stark von dem, was in unserem Außen passiert, gesteuert. Eigentlich reagieren wir nur noch auf das, was passiert, anstatt einen kühlen Kopf zu bewahren, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen und in einen proaktiven Modus zu schalten.
Aber was braucht es, um sagen zu können, dass es sich um ein Umfeld handelt, in dem sich alle sicher fühlen können? Ein Umfeld, in dem das Nervensystem entspannen kann und wir unsere Energie und unseren Fokus auf die Themen legen können, an denen wir arbeiten, und nicht darauf, Gefahr abwenden zu müssen.
Dazu dürfen wir uns wieder unserer Natur zuwenden: Wir sind soziale Wesen, wir benötigen die Verbindung zu anderen, das ist unsere genetische Programmierung. Das heißt, wenn wir uns mit den Menschen, mit denen wir leben oder arbeiten, verbunden fühlen, gibt uns das ein Gefühl von Sicherheit. Neurobiologisch ausgedrückt: wenn der ventrale Vagus im Positiven wirken kann.
Dies geschieht, wenn folgende fünf Punkte erfüllt sind:
- Anerkennung: Unsere Leistung soll wertgeschätzt werden.
- Interesse: Wir wollen als Mensch gesehen werden.
- Respekt: Unsere Bedürfnisse und Gefühle sollen geachtet werden.
- Wohlwollen: Der Blick auf unsere Stärken und das Vertrauen darein, dass wir in positiver Absicht handeln, geben uns Sicherheit.
- Selbstbestimmung: Wir benötigen Wahlmöglichkeiten.

Birgit Schumacher interessierte sich schon in ihrem Volkswirtschaftsstudium für die Beantwortung der Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Menschen kooperieren und gut zusammenarbeiten können. In ihrer praktischen Arbeit als Wirtschaftsmediatorin und Coach unterstützt sie Führungskräfte und Geschäftsführer*innen dabei, ein Umfeld zu etablieren, in dem die Mitarbeitenden neue Ideen einbringen und Problemstellungen selbstorganisiert lösen. In Workshops und Vorträgen gibt sie Einblick in das Thema der psychologischen Sicherheit und zeigt Ansätze auf, die dafür notwendig sind.