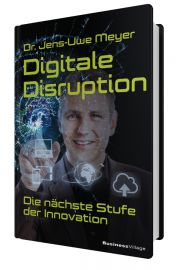Wenn große Ideen am kleinen Dienstweg scheitern, dann läuft etwas falsch. Dennoch werden regelmäßig zukunftsweisende Innovationen, geniale Ideen in den selbst auferlegten Strukturen zerrieben. Aber es gibt auch Unternehmen, die sich frei an der Genialität und dem Ideenreichtum ihrer Mitarbeiter bedienen. Was den kleinen Unterschied macht, verrät der Innovationsexperte Jens Uwe-Meyer.
In Unternehmen mit einer proaktiven Innovationskultur fällt außenstehenden Beobachtern vor allem eines schnell auf: Es wird anders kommuniziert. Bereichsgrenzen werden scheinbar mühelos überwunden, so sie denn überhaupt existieren. An vielen Stellen des Unternehmens reden Mitarbeiter unterschiedlichster Abteilungen miteinander, spinnen gemeinsam Ideen und starten Projekte. Vieles wird auf dem ›kurzen Dienstweg‹ erledigt. Die Bereitschaft, Kontakte nach außen aufzunehmen und zu pflegen ist außerordentlich hoch.
Innovative Optimierer und operative Innovatoren haben andere Kommunikationsstrukturen: Mitarbeiter kommunizieren über offiziell festgelegte Austauschkanäle miteinander, mitunter kommunizieren sie überhaupt nicht bereichsübergreifend. Interne Netzwerke sind praktisch nicht vorhanden, und wenn, dann dienen sie nicht dem Austausch von Ideen, sondern sind eher privater Natur. Kontakte nach außen – also zu anderen Unternehmen, Institutionen oder Vereinigungen – bestehen nur eingeschränkt und wenn, dann sind sie ebenfalls nur privater Natur.
Kommunikation ist ein wichtiger Teil von Innovation
Eine Analyse der Kommunikationsstrukturen innerhalb von Unternehmen ist deswegen von zentraler Bedeutung, weil es nicht nur einer der effektivsten, sondern vor allem auch einer der schnellsten Hebel zur Steigerung der Innovationsfähigkeit ist. Und es ist ein Stellhebel, der äußerst pragmatisch ist. So können beispielsweise informelle Netzwerke gebildet werden, ohne dass an bestehenden Hierarchiestrukturen etwas geändert werden muss. Genau diesen Stellhebel jedoch nutzen Unternehmen eher wenig. Dass im Unternehmen ›jeder mit jedem redet‹ und dass Bereichsgrenzen kaum spürbar sind, dieser Aussage stimmen nur 18 Prozent der Befragten voll und ganz beziehungsweise größtenteils zu. Interne Netzwerke zwischen Experten und Innovateuren sind bei nur 26 Prozent der Befragten wirklich ausgeprägt. Und der Aussage, dass durch Kontakte nach draußen ständig frischer Wind ins Unternehmen kommt, stimmen nur 21 Prozent der Befragten voll und ganz beziehungsweise größtenteils zu. Alle diese Faktoren sind bei den proaktiven Innovatoren am deutlichsten ausgeprägt, auch strategische Innovatoren setzen mitunter auf informelle Netzwerke. Bei innovativen Optimierern und operativen Innovatoren spielen sie nur eine untergeordnete Rolle.
Kommunikation – hier unterscheiden sich Innovationskulturen massiv
Dass das eigene Unternehmen ist stark durch Bereichsdenken geprägt ist, dieser Aussage stimmten 32 Prozent der Befragten voll und ganz beziehungsweise größtenteils zu. Und 24 Prozent der Befragten gaben an, dass sich ihre Unternehmenskultur durch viel Geheimniskrämerei und eine fehlende Bekanntheit von strategischen Zielen auszeichne. Dass das Unternehmen offen ist und jeder die Innovationsziele genau kennt, dieser Aussage hingegen stimmten nur 29 Prozent der Befragten zu. Auch das Potenzial von Meetings für neue Ideen wird bei der überwiegenden Anzahl der Befragten nicht genutzt. Bei proaktiven Innovatoren haben Meetings häufig eine andere Funktion: Sie dienen eher der Ideenfindung als der Planung. Bei den anderen Innovationstypen sind Meetings in der Regel mit planerischen Aktivitäten verbunden.
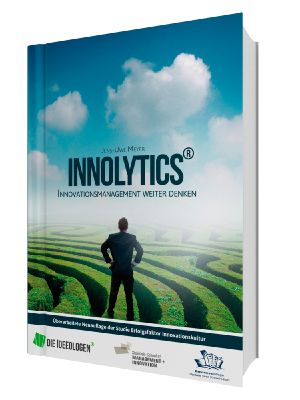
Warum wird der wichtige Stellhebel Kommunikation so wenig genutzt?
Die Ergebnisse unserer Befragung zeigen, dass innovationsfördernde Kommunikationsstrukturen innerhalb von Unternehmen ein hohes Maß an Innovationspotenzial freisetzen können. Nicht nur wenn es darum geht, höhere Innovationsgrade umzusetzen, sondern auch bei der Effizienzsteigerung inkrementeller Innovation. Dass dieses Potenzial bislang nicht genutzt wird, scheint daran zu liegen, dass einem Großteil des Managements informelle Strukturen eher suspekt sind. Durch zahlreiche Fragen unserer Studie haben wir eine hohe Affinität des Managements zu Strukturen entdeckt, die Regeleinhaltung und Kontrolle fördern. Auch die Anforderung, die Auswirkungen aller Handlungen im Unternehmen messbar aufzuzeigen, steht einem Engagement für informelle Netzwerke und Kommunikationsstrukturen entgegen. Der Wert informeller Netzwerke ist schwer messbar, und informelle Kommunikationskanäle bedeuten auch immer ein Stück Kontrollverlust.
Veränderung der Managementkultur
Um das Potenzial von Kommunikationsstrukturen, die Innovation und Kreativität fördern, voll auszuschöpfen, bedarf es einer Veränderung der Managementkultur: einer Kultur, die auch dem informellen Wert beimisst, die Kontrollverlust nicht als Problem, sondern als Chance ansieht und die Bereichsgrenzen nicht als unüberwindbare Hindernisse ansieht. Das bedeutet nicht, dass informelle Kommunikation in jedem Fall gut ist. Die verschiedenen Faktoren einer Innovationskultur sind eng miteinander verzahnt. Die Überwindung von Bereichsgrenzen, interne Netzwerke, externe Kontakte nach außen, die offene Kommunikation strategischer Ziele und kreative Meetings ergeben nur dann Sinn, wenn sie durch die anderen Faktoren – wie beispielsweise der strategischen Ausrichtung und des Anreizsystems – gestützt werden.

Praxisbeispiel: Deutsche Telekom
AG Neben den internen Kommunikationsnetzwerken kommt der Unternehmenskommunikation im Unternehmen eine besondere Rolle zu. Im Gastbeitrag von Harald Lindlar erfahren Sie, welche Rolle Kommunikation spielt und wie sich Kommunikation auf unterschiedlichste Bereiche eines Unternehmens auswirkt. Kommunikation hat zudem einen entscheidenden Einfluss auf die Innovationskultur: Sie gibt Mitarbeitern das Gefühl, dass Innovation eine hohe Priorität hat und sorgt für eine entsprechende Leitwirkung.
Wissenschaftlicher Hintergrund
Alan G. Robinson und Sam Stern vertreten die These, dass Kommunikation einer der wichtigsten Treiber von Innovation ist. »Vielleicht besteht eine natürliche Tendenz des Managements darin, zu glauben, dass es mehr Kontrolle hat, als tatsächlich vorhanden ist«, schreiben sie. Für sie gleicht die Führung eines Unternehmens im Bereich Innovation eher der Führung einer Spielbank: »Obwohl die Spielbank nicht weiß, wie jeder einzelne Spieler an jedem einzelnen Tisch abschneidet, weiß sie doch, dass sie, wenn genügend Kunden kommen und lange genug spielen, einen sehr vorhersehbaren und stabilen Profit generiert.« Im Bereich der Innovation sei es unmöglich vorherzusagen, an welchen Stellen im Unternehmen kreative Handlungen entstehen. Sicher ist nur, dass wenn man eine innovationsfördernde Kultur schaffe, am Ende ein hoher Gewinn an qualitativ hochwertigen Ideen und Innovationsinitiativen entstehe.
Geplante Zufälle als Ideenquelle
Eines der wichtigsten Elemente von Kreativität im Unternehmen ist für die beiden Autoren der ›glückliche Zufall‹. Für diese Art des Zufalls gibt es im Deutschen keine Übersetzung. ›Serendipity‹ ist das, was bei vielen Erfindungen eine Rolle spielt. Erfindungen, die scheinbar zufällig entstanden sind. Jedoch entstanden sie nur deshalb, weil das Unternehmen eine Kultur geschaffen hat, die diesen Zufall möglich gemacht hat. »Kreativität erfordert es häufig, dass Dinge neu kombiniert oder Verbindungen zwischen Dingen gezogen werden, die zuvor nicht miteinander zusammenhingen«, schreiben Robinson und Stern. Innerbetriebliche zufällige Kommunikation ist für die Autoren deshalb ein wesentlicher Bestandteil von Kreativität im Unternehmen. »Unerwartete interne Kommunikation ist etwas, das in kleinen Unternehmen auf normale Art und Weise passiert, jedoch ist es in größeren Unternehmen nicht so normal. Je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Komponenten kreativer Vorgänge bereits irgendwo vorhanden sind, doch desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ohne Hilfe zusammenkommen.«
Innovationsfördernde Kommunikationsstrukturen sind kein Luxus. Sie sorgen dafür, dass das vorhandene kreative Potenzial innerhalb eines Unternehmens zusammenkommt und dass auf Basis dieser Vernetzung Neues entsteht. Durch klassische Kommunikationsstrukturen sind diese Vorgänge praktisch nicht möglich.
Transfer
- Wie bereits erwähnt ist die Einrichtung von innovationsfördernden Kommunikationsstrukturen einer der effektivsten und schnellsten Hebel, um die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens zu steigern. Wichtig ist, dass Führungskräfte auf allen Ebenen in die Etablierung innovationsfördernder Kommunikationsstrukturen involviert werden.
- Vermitteln Sie Ihren Führungskräften, dass innovationsfördernde informelle Kommunikationsstrukturen keine Bedrohung darstellen. Kurzfristig gesehen bedeutet dies zwar, dass Führungskräfte die Kontrolle über einzelne Bereiche verlieren, doch langfristig nutzt das dem gesamten Unternehmen.
- Überprüfen Sie, in welchen Bereichen Abteilungs- und Bereichsdenken Innovation im Weg steht. Listen Sie diese Bereiche auf und erarbeiten Sie einen Maßnahmenplan, um dieses Bereichsdenken zu überwinden.
- Überlegen Sie, welche Rolle Ihre Kommunikationsabteilung beim Aufbau der Innovationskultur spielen kann. Die Bedeutung der internen Kommunikation wird häufig unterschätzt.
- Etablieren Sie Kreativmeetings zu bestimmten Themen in Ihrem Unternehmen. Sorgen Sie dafür, dass der Austausch von Ansichten nicht nur der Planung und der Diskussion dient, sondern vor allem auch der Inspiration. Überlegen Sie, welche Menschen in Ihrem Unternehmen sich gegenseitig befruchten und laden Sie sie zu Meetings ein, in denen sie gemeinsam Ideen entwickeln. Überlegen Sie, welche inspirierenden Kontakte nach ›draußen‹ Ihre Innovationsprojekte voranbringen würden: Sind es Beziehungen zu Universitäten? Zu technologischen Forschungseinrichtungen? Oder zu besonders innovativen Unternehmen aus anderen Branchen? Bauen Sie ein solches Netzwerk von Inspirationsquellen rund um Ihr Unternehmen auf.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick
- Operative Effizienz erfordert häufig klare Kommunikationskanäle innerhalb von Bereichsgrenzen – innovative Exzellenz hingegen fachübergreifende Kommunikation.
- Nur jedes vierte Unternehmen nutzt interne und externe Netzwerke zwischen Innovatoren, Experten und Außenstehenden konsequent.
- Die überwiegende Anzahl interner Meetings wird für Planung und Diskussion genutzt, nicht für systematische Ideenentwicklung.
- Inoffizielle Netzwerke sind ein starker Innovationstreiber und relativ einfach zu etablieren – sie werden von der Mehrheit der Unternehmen nicht konsequent genutzt.
- Eine Veränderung der Kommunikationskultur setzt eine begleitende Veränderung der Managementkultur voraus.

Mit zwölf Büchern (u.a “Digitale Disruption“. „Radikale Innovation) gilt Dr. Jens-Uwe Meyer als führender Vordenker und Keynote Speaker für Innovation und Digitalisierung. Er gehört zur exklusiven Riege der Meinungsmacher beim manager magazin. In seiner Promotion untersuchte er, was Unternehmen zu Innovation Leaders macht. Als Unternehmer entwickelt er heute Software, mit der Unternehmen und Organisationen zu digitalen Gewinnern werden.