Zwischenmenschliche Kommunikation ge-staltet sich überaus facettenreich. Entsprechend erscheint auch das Gespräch selbst in vielfältigen Formen und fächert sich auf in verschiedene Gesprächstypen. Diese lassen sich sehr gut unterscheiden anhand der Überlegung, worauf der jeweilige Fokus des Gesprächs gerichtet ist.
Auf diesem Wege können wir sechs Arten identifizieren:
- Das Gespräch: Der Fokus richtet sich auf den Partner.
- Die Diskussion: Der Fokus richtet sich auf die Sache.
- Die Debatte: Der Fokus richtet sich auf den Sieg.
- Das Interview: Der Fokus richtet sich auf Sie.
- Die Rede: Der Fokus richtet sich auf das Überzeugen.
- Die Verhandlung: Der Fokus richtet sich auf Sie und den Partner.
In den alltäglichen Kommunikationsprozessen sind diese Typen nicht immer eindeutig voneinander zu trennen und manchmal nur schwer zu erkennen. Daher sollen Ihnen die folgenden Spezifizierungen Orientierungshilfen geben, sodass Sie sensibler und bewusster die Unterschiede der einzelnen Konstellationen wahrnehmen können.
Anschließend werden Sie kommunikative Situationen besser und klarer einschätzen können, und vielleicht werden Sie Manipulationsversuchen oder Hemmnissen eher auf die Schliche kommen. Denn manchmal scheitert eine effektive Interaktion allein schon daran, dass Ihr Gegenüber das Geschehen zum Vorteil seiner persönlichen Zwecke beeinflussen will, oder weil nicht allen Beteiligten bewusst ist, worum es wirklich geht (oder gehen sollte!).
Gespräch (es geht um den Partner)
Es ist bereits deutlich geworden, wie wichtig es ist, Kommunikation wirklich partnerschaftlich zu gestalten. Das gemeinsame Ziel dabei ist die erfolgreiche Verständigung. Ein Gespräch verfolgt genau das: die gelungene Verständigung. Die Gesprächspartner tauschen Informationen, Ansichten, Begebenheiten etc. aus – das Ziel ist, sie einander nahe zu bringen und verständlich zu machen.
Gegenseitiges Verstehen und das richtige Erfassen dessen, was der andere ausdrücken möchte, ist grundlegendes Anliegen eines guten Gesprächs. Auf dieser Basis kann sich zwischen den Gesprächspartnern ein Wechselspiel entwickeln, in dem jeder das Gesagte des anderen aufnimmt, darauf eingeht und reagiert. So entfaltet sich ein Gespräch, das von dem Miteinander der Beteiligten getragen und angetrieben wird.
Voraussetzung für solch ein Miteinander ist eine bestimmte Einstellung zum Gespräch und zum Gesprächspartner: Es geht in einem Gespräch nicht darum, das Gegenüber argumentativ zu bezwingen, sondern darum, es zu einem Partner zu machen, um erfolgreich kommunizieren zu können. Das ist der Zweck von Gesprächen: miteinander so zu sprechen, dass man sich gegenseitig versteht.
Diskussion (es geht um die Sache)
Die Diskussion ist eine besondere Form des Gesprächs. Hier geht es letztlich ebenfalls um Verständigung, jedoch in einer spezielleren Form: Die explizite Klärung eines bestimmten Sachverhalts steht im Vordergrund. Über diesen Sachverhalt soll nach Klärung der Details, Fragen und Ansichten Einigkeit oder zumindest ein Konsens unter den Beteiligten erzielt werden.
Dazu werden relevante Informationen und entsprechende Argumentationen von den Teilnehmern in die Diskussionsrunde eingebracht und dort hinsichtlich des infrage stehenden Sachverhalts gemeinsam erörtert.
Gegenstand einer Diskussion kann eigentlich jedes denkbare Thema sein, zu dem Klärungsbedarf zwischen den Beteiligten besteht. Verschiedene Ansichten und Meinungen zu einem Thema, Pro- und Contra- Erwägungen, Alternativen oder offene Fragen können gemeinsam besprochen und erläutert werden, um letztlich auch zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
In einer Diskussion geht es jedoch nicht darum, die eigene Meinung allen anderen Teilnehmern aufzudrängen und deren Ansichten einfach zu eliminieren. Das Ziel ist es, so zu argumentieren, dass die eigenen Argumente und Schlussfolgerungen für die anderen nachvollziehbar und plausibel sind. So können diese dann eigenständige Schlüsse ziehen, die die vorangegangenen Diskussionsbeiträge fortführen, ergänzen oder auch hinterfragen und die Diskussion insgesamt voranbringen. Dazu ist es natürlich zwingend notwendig, dass jeder den einzelnen Redebeiträgen wirklich aufmerksam und offen zuhört und sich mit den Ansichten der anderen ernsthaft auseinander setzt. Dann ist es möglich, mit den eigenen Beiträgen auf die Meinung anderer konstruktiv Bezug zu nehmen, die Argumentation gemeinsam fortzuführen und schließlich zu einem befriedigenden Abschluss zu kommen.
Leider gibt es jedoch auch immer wieder Fälle, in denen man den Eindruck gewinnt, dass Diskussionen unnötigerweise geführt werden. Nicht selten haben politische Gesprächsrunden diesen Beigeschmack. Das liegt in den überwiegenden Fällen daran, dass das grundsätzliche Anliegen von Diskussionen missachtet wird: Diskussionen sollen Klärung in eine bestimmte Sache bringen. Sie dürfen nicht um ihrer selbst willen geführt werden, bloß weil einige der Beteiligten sich so gern diskutieren hören oder sich profilieren möchten. Das Thema – die Sache – steht im Fokus der Kommunikation.
Grundregel für Diskussionen
Der Sinn einer Diskussion ist der Austausch von Inhalten, nicht die Profilierung von Beteiligten!
Es geht um den Inhalt, nicht um mögliche Profilierungsbestrebungen von einzelnen Beteiligten.Wird dieser Grundsatz unterlaufen, wird die gesamte Konstruktion demontiert, und die Diskussion ist keine Diskussion im eigentlichen Sinne mehr.
Debatte (es geht um den Sieg)
Ging es in den bisher behandelten Gesprächstypen darum, sich miteinander zu verständigen oder gemeinsam etwas zu klären, so geht es in der Debatte nun eindeutig um etwas anderes: Es geht um den argumentativen Sieg.
Schon das Wort „Debatte“ selbst sagt über den Charakter dieses Gesprächstyps eine Menge aus. Die Herkunft vom lateinischen „battuere“ (schlagen) und die Verwandtschaft zum englischen Wort „battle“ (Schlacht) legen nahe, dass es sich hier wohl kaum um ein friedvolles Aufeinanderzugehen handelt. Erinnern Sie sich kurz an die letzte Bundestagsdebatte, die Sie verfolgt haben, oder, besser noch, an die Rededuelle amerikanischer Präsidentschaftskandidaten. – Dann sehen Sie diese Vermutung sicher bestätigt.
Anders als beim Gespräch oder bei der Diskussion richtet sich die Debatte nun in erster Linie nicht an den direkten Gesprächspartner, sondern an das Publikum, das von der jeweiligen (gegensätzlichen) Meinung der gegnerischen Parteien in der Debatte überzeugt werden soll. Das Ziel besteht also nicht darin, mit dem „Gegner“ in irgendeiner Form übereinzukommen, sondern ganz klar um die Durchsetzung der eigenen Meinung auf Kosten des „Gegners“. Eine polemische Ansprache an das Publikum soll zu diesem Zweck die eigenen Ansichten darlegen und sie so überzeugend wie möglich darstellen. Die eigene Meinung ist dabei schon vor Beginn der Debatte fixiert und steht selbst eben nicht mehr zur Debatte. Es geht nur noch darum, die Zuhörer von der Richtigkeit der eigenen Meinung zu überzeugen und die Ansichten des Gegners zu diskreditieren. Doch vergessen Sie nicht: Beide Kontrahenten haben dieses Ziel und stehen zum Kampf bereit!
Rede (es geht ums Überzeugen)
Auch beim Halten einer Rede geht es darum, die Zuhörer von dem Vorgetragenen und auch vom Vortrag selbst zu überzeugen. Doch im Gegensatz zur Debatte gibt es bei der Rede keinen Gegner, den es zu besiegen gilt. Der Sieg spielt hier keine Rolle. Sie können sich ganz auf Ihre Qualitäten besinnen und die Zuhörer mithilfe eines guten Kommunikationsvorganges überzeugen.
Inwiefern auch die Rede einer einzelnen Person ein Gespräch ist, haben Sie bereits auf den Seiten 12 ff. in den Erläuterungen zum Sender-Empfänger-Modell erfahren. Kurz zusammengefasst lässt sich dazu wiederholen, dass auch zwischen Redner und Publikum eine wechselseitige Interaktion stattfindet, die von Seiten der Zuhörer allerdings überwiegend auf nonverbaler Ebene stattfindet.
Die Zuhörer senden unaufhörlich Reaktionen in Form von nonverbalen Signalen an den Redner auf die er ebenso reagiert, wie das Publikum auf seinen (verbalen) Vortrag und seine nonverbalen Signale. In dieser Weise gestaltet sich also auch die Situation einer Rede durchaus dialogisch. Das aber nur kurz zur Erinnerung.
Die wesentlichen Merkmale der Redesituation sind folgende: Die Verantwortung für das Gelingen der Rede liegt beim Redner. Er steht permanent im Zentrum der Aufmerksamkeit, und durch den bereits im Vorfeld festgelegten Ablauf der Rede ist kaum mehr Spielraum im Argumentationsaufbau. Die eigene Argumentation muss im entscheidenden Augenblick die Überzeugungsarbeit leisten können. Als Redner steht man allein vor einem zahlenmäßig weit überlegenen Publikum, von dem im besten Falle Wohlwollen, jedoch kaum Beistand zu erwarten ist.
Angesichts dieser Umstände ist es gar nicht so schwer nachzuvollziehen, dass eine Rede einen schon mal ins Schwitzen bringen kann. Und dass man im Alltag einigermaßen leichtfüßig kommunizieren kann, heißt noch lange nicht, dass man auch ein guter Redner ist. Dazu gehört einiges mehr.
Interview (es geht um Sie)
Im Interview steht nun ganz eindeutig die Person des Interviewten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der rhetorischen Bemühungen. Dabei geht es entweder darum, direkt die interviewte Person vorzustellen (Personalinterview) oder diese Person beispielsweise als Experten zu einem Sach-thema zu befragen (Sachinterview). Nicht selten werden diese beiden Formen des Interviews miteinander vermischt, wenn zum Beispiel der Experte erst einmal als Experte vorgestellt, seine Autorität in der Sache dargestellt werden soll und er anschließend zum Thema Auskunft gibt.
Oft geht es im Interview ausgerechnet um die Informationen, die der Interviewte lieber nicht preisgeben würde. Das sehen Sie tagtäglich in Interviews von Journalisten, die Politikern oder hohen Wirtschaftsfunktionären zumeist sehr unangenehme Fragen stellen.
Doch auch dabei geht es eigentlich um die Person selbst: Welche Informationen hat diese Person? Welche davon gibt sie preis? Wie stellt sie die Informationen dar? Wie stellt der Interviewte sich selbst dar? Was haben diese Informationen mit ihm selbst zu tun? Inwieweit betrifft das Zurückhalten von Informationen seine eigene Person? – Fragen wie diese stehen oft hinter der journalistisch investigativen Befragung einer Person. Doch nicht nur im journalistischen Bereich finden Interviews statt. Ein Bewerbungsgespräch, das Sie führen oder das mit Ihnen geführt wird, ist zugleich auch ein Interview. Der Personalchef möchte auf dem Wege der Befragung Informationen über die Persönlichkeit des Bewerbers und dessen Qualifikationen, Fähigkeiten etc. erhalten. Das Interview ist also den meisten Menschen nicht nur aus der Anschauung, sondern auch aus eigener Erfahrung recht geläufig.
Verhandlung (es geht um Sie und den Partner)
Die Notwendigkeit zu verhandeln ergibt sich immer dann, wenn anlässlich einer anstehenden Entscheidung unterschiedliche Interessen der Beteiligten aufeinander treffen, die in irgendeiner Form vereinheitlicht werden müssen. Die Parteien müssen dann eine Variante aushandeln, die die unterschiedlichen Interessenlagen berücksichtigt und auf die sich beide Seiten einigen können, sodass die Entscheidung zustande kommt, tragfähig ist und umgesetzt werden kann.
Verhandlungen finden nicht nur statt, wenn beispielsweise Firmen miteinander Geschäfte machen oder politische Parteien Koalitionen bilden wollen. In ganz alltäglichen Zusammenhängen treten überaus häufig Fälle auf, in denen verhandelt werden muss: mit den Kindern um das Taschengeld oder die Fernsehzeiten, mit dem Partner um die Einrichtung der neuen Wohnung, mit Freunden um das nächste Ausflugsziel fürs Wochenende oder um das Restaurant für den Abend, mit dem Geschäftspartner um die Investition in eine neue Anschaffung etc.
In all diesen Beispielen steht eine Entscheidung bevor (über die Höhe des Taschengeldes, die Dauer der Fernsehzeiten, über die Höhe einer Investition etc.), für die beide Parteien bei auseinander gehenden Interessen einen Ausgleich finden müssen. Denn die Entscheidung kann ansonsten nur auf Kosten einer der Parteien getroffen werden. Und da das eigentlich niemand gern mit sich machen lässt, entstehen auf diese Weise immer wieder aufs Neue Verhandlungssituationen.
Der entscheidende Punkt dabei ist: Auch wenn die Interessen in der Sache auseinander gehen, besteht letztlich Einigkeit darüber, dass man sich einigen muss und will. Das ist die Grundlage für den Beginn von Verhandlungen.
Egal, ob es sich um großes Business oder um private Interessenkonflikte handelt, die grundlegenden Merkmale der Verhandlungssituation und die Anforderungen an die Verhandlungspartner bleiben die gleichen.
Das Ziel einer Verhandlung ist es, mit dem Verhandlungspartner so übereinzukommen, dass zum einen die infrage stehende Entscheidung überhaupt getroffen und umgesetzt werden kann und zum anderen beide Parteien gleichermaßen einen Vorteil davon haben.
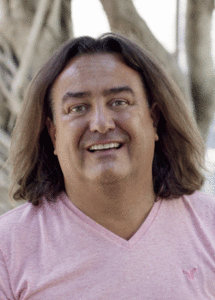
Stéphane Etrillard zählt zu den meistgefragten Wirtschaftstrainern und Business-Coaches. Als Experte für persönliche Souveränität und Unternehmersouveränität ist er Autor von über 40 Büchern. Sein einzigartiges Know-how ist in den letzten 20 Jahren in der Begleitung von über 25.000 Unternehmern und Managern entstanden. Seine Unternehmercoachings wenden sich an Unternehmer, die erfolgreich werden und bleiben wollen und vor allem mit Leistungen am Markt auftreten wollen, die auch gekauft werden.

