Unternehmen haben verschiedene Arten von Anreizsystemen entwickelt, um die Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter zu erhöhen. Hintergrund solcher Bemühungen ist die oben bereits erläuterte Erkenntnis, dass latente Motive durch Anreize wie etwa Mangelzustände oder attraktive Hinweise im Umfeld aktualisiert werden und dann die Handlungssteuerung der Person übernehmen. Wir wollen derartige Anreize der Leistungsmotivation genauer analysieren und deren Wirkung auf Arbeitnehmer verdeutlichen. Sie entscheiden selbst, welche Konsequenzen Sie daraus ziehen.
Zunächst geht es um Anreize, die auf extrinsische Arbeitsmotive zielen, also solche, die sich von außerhalb auf den Mitarbeiter richten und bei denen die Folgen der Tätigkeit maßgeblich sind. Nach Auffassung der Arbeitspsychologie sind dies vor allem Geld, Sicherheit und Geltung, deren Erwerb oder Aufrechterhaltung angestrebt bzw. deren Verlust zu vermeiden versucht wird.
A. Zur Wirkung finanzieller Zuwendungen
Die Aufgabenbereiche für Außendienstmitarbeiter sind je nach Region, Produkten und Marketingstrategien sehr unterschiedlich, so dass die Entlohnungssysteme entsprechend den firmenspezifischen Gegebenheiten ausgestaltet werden. Der Autor beabsichtigt an dieser Stelle nicht, Ihnen wirtschaftswissenschaftliche Erörterungen zum Pro und Contra unterschiedlicher Vergütungssysteme zu servieren. Näheres dazu können Sie nachlesen in den Aufsätzen von Koinecke (Koinecke, Jürgen, 1998: Moderne Instrumente zur leistungssteigernden Entlohnung) bzw. von Hoegen (Hoegen, Cornel von, 1998: Neue Wege der Außendienstentlohnung). Es geht hier lediglich darum, die gängigen finanziellen Anreize kurz zu benennen, um dann deren mögliche oder wahrscheinliche Auswirkungen auf die Mitarbeitermotivation offen zu legen.
Die Arbeitsleistung von Mitarbeitern wirkt sich signifikant auf den wirtschaftlichen Gesamterfolg eines Unternehmens aus. Gute Außendienstmitarbeiter sind gesuchte Kräfte, da sie über spezifisches Fachwissen und viele persönliche Kontakte verfügen. Jeder von ihnen versucht, die Höhe der von anderen Firmen angebotenen Entlohnung herauszufinden, um sie mit seiner eigenen vergleichen zu können. Daher bemühen sich Unternehmen, gute Mitarbeiter durch eine attraktive Entlohnung an sich zu binden, denn ihr Wechsel zum Wettbewerb würde hohe Einbußen bedeuten. Kunden fühlen sich nämlich häufig stärker der direkten Kontaktperson als dem dahinter stehenden Unternehmen verbunden.
Als Vertriebsleiter wissen Sie, dass Produkte eine Art Lebenszyklus haben und dass sich von daher die Anforderungen an die Außendienstmitarbeiter verändern: Zunächst geht es um das Gewinnen von Kundeninteresse für das Produkt sowie um die Darstellung seiner Merkmale und Funktionen. Später liegt das Hauptaugenmerk auf der Durchsetzung gegenüber Konkurrenzprodukten und im Kundenservice. Häufig erkennen Außendienstmitarbeiter solche Veränderungen am Markt eher als das für die Entlohnung zuständige Management. Sie werden enttäuscht oder sogar demotiviert, wenn trotz ihrer Anstrengungen, dem veränderten Bedarf gerecht zu werden, keine Umstellung in der Vergütung erfolgt. Als Führungskraft im Vertrieb können Sie aus Ihrer Position gegenüber dem Management die Interessen Ihrer Mitarbeiter vertreten. Ihr Team sollte unbedingt von Ihrem Engagement für den Außendienst erfahren (PR-Grundsatz: Tu Gutes und sprich darüber!). Sie werden merken, dass es den wenigsten Mitarbeitern bei ihrer Arbeit ausschließlich um mehr Geld geht. Die auf diese Weise zum Ausdruck gebrachte Anerkennung durch den Vorgesetzten kann einen viel stärkeren Motivationsschub auslösen. Davon später mehr.
Im Außendienst wird üblicherweise mit variablen Vergütungssystemen operiert, d.h. die Zahlung wird aufgeteilt auf ein Fixum und eine erfolgsabhängige Lohnkomponente. Deren Ausgestaltung wird unterschiedlich vorgenommen: Die häufigsten Formen sind Provisionen, bei denen ein bestimmter Prozentsatz der Umsätze bzw. der Gewinnmargen vergütet wird, und Bonuszahlungen, also die Auszahlung festgelegter Summen für das Erreichen bestimmter Zielvorgaben. Maßstab für die Messung des Erfolges ist häufig der Umsatz; es kann aber auch der Produktmix sein, der besagt, welche Produkte verkauft wurden oder die Preisfestsetzung, die die beim Geschäft ausgehandelten Konditionen beschreibt. Zu den monetären Anreizen von Unternehmen für Mitarbeiter gehören weiter das Angebot von Betriebsrenten oder auch das Einräumen günstiger Kredite. Eine Kapital- oder Gewinnbeteiligung, für die es verschiedene Modelle gibt wie beispielsweise Erfolgsbeteiligung, Aktienoptionen, Genussrechte, Stille Beteiligungen oder andere Investitionsformen, bieten in Deutschland lediglich 25% aller Betriebe mit mehr als 200 Beschäftigten ihren Mitarbeitern an. Mitarbeiterbeteiligungen sind insofern ein Sonderfall, als sie nicht nur auf extrinsische Motive abzielen, sondern ein hochkomplexes Arrangement darstellen, das auch immaterielle Anreize integriert.
“Money makes the world go round” – stimmt das eigentlich noch? Nach dem 2. Weltkrieg bis zum Ende der 70er Jahre gab es bei uns durchaus einen materiellen Nachholbedarf, sicherlich ebenso nach der Wiedervereinigung in den ostdeutschen Bundesländern. Untersuchungen seit Ende der 80er Jahre zeigen jedoch, dass sich Menschen heute keineswegs allein durch mehr Geld zu höheren Anstrengungen bewegen lassen: So waren bei einer 1989 durchgeführten Befragung bei der Deutschen Bank 80% der Mitarbeiter der Meinung, Lust und Spaß an der Arbeit seien wichtiger als das Einkommen (Sprenger, Reinhard K., 1992). Es sollte auch nachdenklich machen, daß viele Menschen sich mit Begeisterung ehrenamtlichen Tätigkeiten widmen, ohne viel Geld dafür zu bekommen – seien es der Einsatz für das Rote Kreuz, die Betätigung als Sporttrainer oder auch die Übernahme der Leitung von Jugendfreizeiten.
B. Wie andere materielle Zuwendungen wirken
Die Vielfalt möglicher ,,Bonbons” für Mitarbeiter kann hier nicht aufgezählt werden – Sie haben sicherlich Ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht. Betriebsausflüge, gemeinsame Essen, Einkaufsgutscheine, Theaterkarten fürs Weihnachtsmärchen für die ganze Familie, attraktive Reisen, Fortbildungen in exklusivem Ambiente – ein ganz neuer Erwerbszweig ist entstanden: Event-Agenturen, die Veranstaltungen aushecken und organisieren, die Firmen-Mitarbeiter bei Laune halten sollen.
Beispiel: Ein großes Versicherungsunternehmen lädt alle Außendienstmitarbeiter eines Strukturvertriebs zu einem Wochenende in ein exklusives Hamburger Hotel ein. Das Rahmenprogramm lässt sich sehen: Nach der obligatorischen Besichtigung der Konzernzentrale findet eine Alster-Rundfahrt statt. Der Abend wird von einer Eventagentur organisiert: Ein Rahmenprogramm mit ausgewählten Künstlern, Musik und Champagner bis zum Abwinken runden das Erlebnis ab.
Kaum jemand wird dergleichen Angebote verschmähen –aber glauben Sie wirklich, dass dadurch die Leistungsmotivation Ihrer Vertriebsmitarbeiter längerfristig gesteigert werden kann?
Beispiele: Betriebsausflüge zur Förderung des Zusammengehörigkeitsgefühls sind häufig familienfeindlich, da sie am Wochende unternommen werden. Nicht alle Mitarbeiter haben Lust, etwa mit ungeliebten Kollegen noch mehr Zeit zu verbringen.
Geschenke, die die Familien einbeziehen, können bei diesen fatale Assoziationen auslösen: Da der Vater wegen seines Einsatzes für die Firma fast nie zu Hause ist und die Familie im Alltag ohne ihn zurechtkommen muss, hat die Unternehmensleitung wohl ein schlechtes Gewissen, denn ein solcher Umgang mit Arbeitnehmern kann nicht in Ordnung sein. Derartige Präsente sind also Bestechungsversuche, denen gegenüber Misstrauen angebracht ist … – was nicht ohne Auswirkung auf die Motivation des Mitarbeiters bleibt.
Durch materielle Anreize der oben genannten Art entstehen bei Mitarbeitern Erwartungen, die sich auf die stetige Qualitätssteigerung der Incentives richten. Wenn ein solcher Verwöhnungseffekt entsteht – der durch Gleichbehandlung aller Mitarbeiter noch gesteigert wird –können die Anreize jede Auswirkung auf die Leistungsmotivation verlieren und sind dann nur noch Anlass für Witzeleien im Kollegenkreis.
C. Den sportlichen Ehrgeiz wecken: Wettbewerbe und Prämiensysteme
Auch die Folgen von Wettbewerben und des Auslobens von Prämien sollten Sie beachten. In der Ratgeberliteratur für den Vertrieb ist häufig die Rede vom sportlichen Ehrgeiz, der zu wecken sei. Außendienstmitarbeiter werden dort verglichen mit Spitzensportlern, deren Leistungsmotivation durch nichts zu erschüttern ist und die es weit gebracht haben – wie beispielsweise Arnold Schwarzenegger. Dieser Vergleich soll dann die Mitarbeiter zu ständigen Spitzenleistungen anspornen. Unterstellt wird dabei das allgemeine Vorherrschen des Wettbewerbsmotivs und des Geltungsstrebens, denn diese beiden Orientierungen werden angesprochen durch die Möglichkeit, Sieger zu werden und Prämien zu kassieren.
Es mag durchaus sein, dass in Ihrem Team wettbewerbs-orientierte Mitglieder arbeiten. Das wird jedoch nie auf alle zutreffen. Wer gezwungenermaßen an einem Wettbewerb teilnimmt, wird niemals über sich selbst hinauswachsen und eher von Selbstzweifeln geplagt werden nach dem Motto: ,,Das schaffe ich nie!”. Bei Wettbewerben gibt es immer Verlierer, deren Erfolgszuversicht (eine Bedingung für Leistungsmotivation, s.o.) dadurch eher unterminiert wird. Sie werden bestraft, statt für ihren Einsatz belohnt zu werden. Die regionalen Gegebenheiten im Außendienst sind in der Regel sehr unterschiedlich, so dass von fairen Bedingungen auch für Team-Wettbewerbe kaum die Rede sein kann. Die Finanzkraft von Kunden beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern dürfte erheblich abweichen von derjenigen im Großraum Stuttgart, und dann nützt auch hohe Anstrengungsbereitschaft dem Außendienstmitarbeiter und dem Unternehmen wenig.
Fazit: Die Folge von Wettbewerbs- und Prämiensystemen ist hohe Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, die keinen Zutritt zum Siegertreppchen haben – und außerdem Unlust, sich besonders anzustrengen. Es kann nicht in Ihrem und im Interesse Ihrer Firma sein, Demotivation zu erzeugen.
D. Voraussetzungen und Folgen extrinsischenMotivierens
Die eben beschriebenen Versuche von Unternehmen, die Leistungsmotivation über das Ansprechen extrinsischer Motive zu steigern, kommen immer noch häufig vor. Es lohnt sich, die eigentlichen Grundlagen dieser Praxis genauer zu betrachten, nämlich das aus der Lerntheorie bekannte operante Konditionieren, das bei der Dressur von Tieren im Zirkus immer noch erfolgreich angewendet wird. Dieses Prinzip besagt schlicht, dass ein Verhalten dann vermehrt ausgeübt wird, wenn es positive Konsequenzen nach sich zieht, dagegen bei Bestrafung unterlassen wird. Entdeckt wurde dieser Effekt bei Tieren (vor allem Burrhaus F. Skinner), und lange Zeit übertrug man die Ergebnisse auf Menschen, und zwar ohne Rücksicht darauf, dass Menschen denken und fühlen können. Die Psychologie hat sich längst über diesen Forschungsstand hinaus entwickelt und untersucht derzeit vor allem, wie sich Emotionen und Denken bei der Verhaltenssteuerung gegenseitig beeinflussen. Menschen sind keine Reiz-Reaktions-Automaten, die mechanistisch gelenkt werden können, und daher sind bei der Orientierung auf extrinsische Arbeitsmotive keine langfristigen Effekte zu erwarten.
Sie können davon ausgehen, dass Ihre Mitarbeiter sensibel sind für das, was von ihnen erwartet wird, und das heißt auch, welche Einschätzung ihre Vorgesetzten und die Unternehmensleitung von ihnen haben. Diese Einschätzung wird nicht nur durch Worte kommuniziert, sondern durch die gesamte Unternehmenskultur. Das Ansprechen extrinischer Arbeitsmotive bedeutet im Klartext, dass den Mitarbeitern kein Vertrauen entgegengebracht wird (vgl. Sprenger, Reinhard K., 1992). Es bedeutet: ,,Mein Vorgesetzter glaubt, dass ich nicht bereit bin, vollen Einsatz zu leisten. Deshalb versucht er, mich durch Bestechung zu hundertprozentiger oder noch höherer Leistung zu bringen. Wenn ich diese Leistung nicht erbringe, gleichgültig, wie sehr ich mich anstrenge, werde ich bestraft. Das finde ich ungerecht, und wenn ich nicht meine Familie zu versorgen hätte, wüsste ich, was ich täte …”. Was halten Sie von dieser ,,Leistungsmotivation”? Was, wenn das Gegenteil erreicht wird, wenn also vorhandene Leistungsmotivation durch die beschriebenen Motivierungsbemühungen zerstört wird?
Beispiel: Sie haben Ihrer alten Nachbarin geholfen, ihren Keller aufzuräumen und einiges an Sperrmüll an die Straße zu schleppen. Es hat Ihnen Spaß gemacht, sich körperlich anzustrengen und Sie schauen sich befriedigt den ordentlichen Keller und den Gerümpelhaufen auf dem Bürgersteig an. Da kommt die alte Dame mit ihrem Portemonnaie an, erklärt, sie wolle nichts geschenkt haben, und versucht, Ihnen 30 Euro aufzudrängen. Wie fühlen Sie sich?
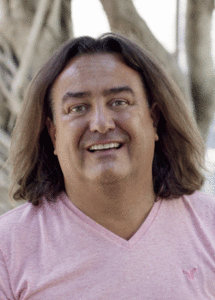
Stéphane Etrillard zählt zu den meistgefragten Wirtschaftstrainern und Business-Coaches. Als Experte für persönliche Souveränität und Unternehmersouveränität ist er Autor von über 40 Büchern. Sein einzigartiges Know-how ist in den letzten 20 Jahren in der Begleitung von über 25.000 Unternehmern und Managern entstanden. Seine Unternehmercoachings wenden sich an Unternehmer, die erfolgreich werden und bleiben wollen und vor allem mit Leistungen am Markt auftreten wollen, die auch gekauft werden.

