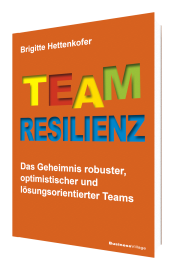Ein Team besteht aus mehreren Personen … Da könnte man doch die Schwarmintellligenz der Gruppe Nutzen um neue Herausforderungen zu meistern und kreative Ideen zu entwickeln. Doch Vorsicht - auch ein Schwarm kann dumm sein, eine Gruppe muss nicht automaisch besseres Leisten der Einzelne. Denn Gruppendenken ist der Irrglaube, dass Kooperation die besten Lösungen produziert. Er entsteht in homogenen Gruppen, die sich sozial und beruflich ähneln, in denen Minderheitenmeinungen ignoriert werden, keine Führung existiert, Entscheidungen unter Stress getroffen werden und die Gruppe eng zusammenhält. In diesem engen Zusammenhalt fühlen sich die meisten Teammitglieder aufgehoben. Leider entsteht dann wenig Raum für Weiterentwicklung. Das Team ist mit sich selbst beschäftige und jede neue Denkweise wird schnell als Bedrohung gesehen und bekämpft. Ein perfektes Gemisch für Stillstand.
Das Reden über Probleme schafft Probleme,
Steve de Shazer (1911–2005),
das Reden über Lösungen schafft Lösungen.
US-amerikanischer Psychotherapeut und Autor
Diese Aussage klingt wie ein kluger Kalenderspruch und schon legen wir die Aussage wieder auf die Seite. Das Interessante daran ist, dass diese rein semantische Unterscheidung reale Konsequenzen im Gehirn hat. Denn jeder Gedanke verändert unser Gehirn. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Beschäftigen wir uns ausführlich mit den Problemen, führt das zu weiteren Problemschleifen mit all seinen vorhersagbaren Nebenwirkungen. Wir können nicht gleichzeitig ein Problem betrachten und eine Lösung finden, dazu ist unser Gehirn nicht in der Lage. Wir müssen eine bewusste Entscheidung treffen, uns auf die Lösung, statt auf das Problem zu konzentrieren – ein elementarer Unterschied für unser Gehirn. Dabei sollten erst mal auch verrückte Lösungsideen zugelassen werden. Natürlich müssen verrückte Ideen auf ihr Alltagstauglichkeit überprüft werden.
Die Geschichte des Barons von Münchhausen, der sich aus eigener Kraft aus dem Sumpf zog, dient als Metapher dafür, dass man mit der eigenen Fantasie und dem Glauben an die eigenen Kräfte Großes erreichen kann. Wenn ein Team in einer tiefen Problemtrance feststeckt, ist das Bild und das Gefühl des Sumpfes passend. Dabei wird der Sumpf beachtet und die schwierige Situation gewürdigt. Da man sich aus dem Sumpf ziehen will, müssen Kräfte und Ressourcen aktiviert werden. Mit dieser Übung können sich die Teammitglieder wieder stärker auf ihre eigene Wirksamkeit konzentrieren und es entsteht das Gefühl, das Schicksal gestalten zu können und Handhabbarkeit entsteht. Die zentrale Botschaft der Übung ist, dass jeder Einzelne die Macht hat, in seinem Einflussbereich etwas zu bewirken. Und gemeinsamer Einfluss ermöglicht schließlich noch mehr Veränderung. Diese freigesetzte Energie kann zu Initiativen führen, die zur Verbesserung der Team-Resilienz beiträgt.
Der Moderator stellt die beiden Fragen: In welchem Sumpf stecken wir gerade? (Reine Austauschrunde, sollte kurz und knapp gehalten werden)
Welche eigenen Kräfte können wir aktivieren?
Dazu werden nun zwei Bereiche im Raum abgesteckt: Ich als Individuum und Wir als Gruppe. Jede Person wählt einen Raum aus, von wo aus sie starten will, der persönliche Raum oder der Gruppenraum. Nun stellt der Moderator die Arbeitsfragen für die einzelnen Betrachtungsebenen:
- Bereich »Individuum«: Was will ich ganz konkret als einzelnes Teammitglied tun?
- Bereich »Gruppe«: Was wollen wir ganz konkret als Gruppe tun?
Jetzt sammelt zuerst jeder Teilnehmer in Einzelarbeit seine Ideen und nach fünf Minuten teilt jeder seine Gedanken der Gruppe mit. In einem gemeinsamen Brainstorming werden weitere Ideen gefunden und schriftlich auf Moderationskarten festgehalten. Jede Gruppe hat gegen Ende dieser Arbeitsphase eine Pinnwand mit einem Blumenstrauß an Ideen. Bei der Anwendung des Gallery Walk (Steinhöfer 2021: 290) können sich die Teilnehmer die Zeit nehmen, die sie brauchen, um die Ideen der anderen zu verstehen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, wirklich darüber nachzudenken. Die Ergebnisse an den Pinnwänden werden gewürdigt wie wertvolle Exponate in einem Museum, deshalb Gallery Walk. Zunächst lesen sich die Teilnehmer die Informationen noch einmal durch. Verständnisfragen können gestellt werden und weitere Ideen können ergänzt werden. Durch dieses Vorgehen entstehen noch mehr Ideen. Es wird deutlich, wie viele Ideen im Raum sind. Das bringt ein Team wieder in seine Handlungskraft. Es wird Handhabbarkeit erlebt. In einem letzten Schritt werden die Ideen bewertet. Das kann ganz einfach mit einer Punkte-Abstimmung geschehen. Jeder Teilnehmer bekommt jeweils fünf Klebepunkte und es wird abgestimmt, welche Ideen als erstes umgesetzt werden. Die Idee mit den meisten Punkten wird in konkrete Umsetzungsschritte gepackt. ( Playbox)
Vergangene Erfolgsgeschichten aufleben lassen
Auch bewältigte vergangene Belastungs-Situationen können für das Selbstwirksamkeitserleben genutzt werden. Dies ist möglich, wenn ein Team sich gemeinsam Erfolgsgeschichten erzählt und reflektiert, wie sie das hinbekommen haben. Der Austausch von Erfolgsgeschichten über vergangene Belastungssituationen, die gemeistert wurden, kann eine gute Möglichkeit sein, die Selbstwirksamkeit im Team zu stärken. Indem ein Team gemeinsam darüber nachdenkt, wie es in der Vergangenheit gehandelt hat, kann ein besseres Verständnis für Strategien, die funktioniert haben, entwickelt werden. Möglicherweise können diese hilfreichen Strategien auf ähnliche Herausforderungen angewendet werden. Ein Gefühl der Zuversicht und des Glaubens an die innewohnenden Fähigkeiten wird erlebt. Jedes Team hat meist eine mehr oder weniger lange gemeinsame Geschichte. Da gibt es Personen, die sind schon lange im Team, andere sind neu dazugekommen. In dieser Zeit hat ein Team gemeinsame Erfahrungen gemacht. Die gemeinsame Erfahrungsgeschichte beeinflusst die Selbstwirksamkeit im Team, selbst wenn wichtige Beteiligte schon nicht mehr im Team sind.
Dabei suchen Teams in ihrer Vergangenheit nach gemeisterten Problemen. Die Führungskraft kann dazu einladen, dass jedes Teammitglied in die nächste Teamsitzung eine kleine oder auch größere Erfolgsgeschichte aus der gemeinsamen Vergangenheit mitbringt. In der Sitzung werden die Erfolgsgeschichten miteinander geteilt. Und jetzt ist der nächste Schritt wichtig: Mit welchen Ressourcen im Team ist diese Erfolgsgeschichte zustande gekommen? Diese Ressourcen sind im Team schon erfolgreich gelebt worden. Die Ressourcen werden auf Moderationskarten visualisiert, denn nur zu schnell verschwinden die Ressourcen aus unserem Gesichtsfeld und spielen in der Gegenwart plötzlich keine Rolle mehr. Jetzt kommt der Transfer der Ressourcen auf die gegenwärtige Situation: Wie kann eine Ressource bei der Bewältigung der jetzigen Schwierigkeit nützlich sein?
Ein Team bringt die kollektive Erfahrung vergangener Erfolge in die Gegenwart ein, wodurch an das vorhandene Team-Potenzial erinnert wird. Selbst wenn die aktuelle Situation neue Ansätze und Anpassungen erfordert, ist das Team bereit und in der Lage, auf sein kollektives Wissen zurückzugreifen, um Erfolge zu erzielen.
Gemeinsam Neues in die Welt bringen
Es geht darum, Meilensteine für eine weitere Entwicklung zu identifizieren und zukünftige Erfolge zu planen. Dieses Instrument hilft den Teams, eine optimistische Haltung einzunehmen, gemeinsame Chancen zu erkennen und konkrete Handlungsschritte zu unternehmen. Mit der Übung »Crowd Sourcing« aus »Liberating Structures« kann ein Team auf schnelle Weise neue Ideen für eine konkrete Fragestellung entwickeln. (Steinhöfer 2021: 296) Die besten Ideen werden in Handlungsschritte übersetzt. Das Team wird spielerisch aktiviert und kommt relativ schnell weg von der Problemtrance und bewegt sich in den Lösungsraum. Das Team befähigt sich selbst, die innewohnende Kreativität für alltagstaugliche Ideen auszuschöpfen. Mit dieser Übung werden alle Teammitglieder gleichzeitig involviert. Ziel dabei ist, die fünf bis zehn Ideen mit der größten Umsetzungsenergie weiter zu verfolgen.
Übung: Was ist Ihre kühnste, mutigste, originellste und verrückteste Idee, um …?
Alle stehen auf und bewegen sich im Raum, es kann auch Musik im Hintergrund laufen. In der Bewegung kommt auch das Gehirn in Bewegung. Jedes Teammitglied schreibt eine Idee zur Fragestellung auf eine Moderationskarte, es sollte leserlich geschrieben werden. (Es steht kein Name auf der Moderationskarte, das ist wichtig, die Idee bleibt somit anonym). Nun bewegen sich die Teammitglieder mit ihrer Idee frei im Raum und wenn ein Signal zu hören ist, wird die Moderationskarte mit der Person ausgetauscht, die am nächsten steht. Auf der Rückseite wird die Idee auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Insgesamt sollten fünf Tausch- und Bewertungsrunden erfolgen. Nach der letzten Runde werden die Punkte addiert und aufgrund der Punktezahl priorisiert, die Idee mit der höchsten Punktezahl steht an erster Stelle. Bewertet eine Person die Idee mit fünf, bedeutet das auch, sie ist selbst bereit, diese Idee mit umzusetzen ( Playbox).
Für diese Ideenfindung sollten Sie nicht länger als fünfundzwanzig Minuten einplanen. Es ist eine andere Form des Brainstormings. Durch die schriftliche und anonyme Erarbeitung und Bewertung wird keine Idee vorschnell schlecht geredet. Der Charme dieser Übung ist, dass jede Idee aufgeschrieben wird und nicht sofort bewertet wird, jedes Teammitglied ist beteiligt und Bewegung im Raum sorgt für etwas mehr Blut im Gehirn. Im klassischen Brainstorming wird oft die eigene Idee bis aufs Blut verteidigt und die Vorschläge der anderen schnell schlecht geredet. Dieses Übungsformat ist sowohl strukturiert als auch kreativ. Der nächste Schritt besteht darin, die nach Prioritäten geordneten Ideen in umsetzbare Schritte zu übersetzen. Im Anschluss können Sie die 15-Prozent-Lösung (Steinhöfer 2021: 360) zur Umsetzung dranhängen. Maßnahmen und Entscheidungen können schnell im Sande verlaufen, wenn sie zu groß erscheinen. Die Entscheidung ist getroffen, alle sind motiviert, sofort loszulegen, aber dann tun sich große Hürden auf und plötzlich scheint die Lösung des Problems in weiter Ferne zu liegen. Mit 15-Percent-Solutions werden die kleinen Maßnahmen entdeckt. Diese kleinen Maßnahmen haben viel mehr Aussicht auf Erfolg als große, komplizierte Maßnahmen, die viel Zeit, Geld und Genehmigungen erfordern. Gerade aus systemischer Perspektive gilt es immer wieder, genau zu reflektieren, machen schon kleine Interaktionen einen Unterschied zu vorher. Selbst kleine Maßnahmen können eine große Wirkung haben ( Playbox). An den kleinen Umsetzungsschritten wird so lange gefeilt, bis jeder das Gefühl hat, dass es machbar ist. Das Team motiviert sich selbst zum gemeinsamen Handeln und an die Stelle der gefühlten Ohnmacht tritt neuer Antrieb.
»Mit einem Growth Mindset lassen
sich Stärken leichter entwickeln.«
Fazit: Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit geht in turbulenten Zeiten schnell verloren. Umso wichtiger ist es, diese beiden Prinzipien im Blick zu haben. Ein Team, das von seiner eigenen Kompetenz überzeugt ist, erfährt mit größerer Wahrscheinlichkeit Selbstwirksamkeit. Sie haben oft das Gefühl, dass sie etwas bewirken, das heißt, dass sie etwas Bedeutendes tun. Es ist immer wieder notwendig, Denk- und Handlungsräume zu schaffen, in denen ein Team seine eigene Selbstwirksamkeit und Handhabbarkeit erfahren kann.

Brigitte Hettenkofer ist Diplom Theologin, Business Coach, Resilienz Trainerin, Neuroimaginations® Coach und lösungsorientierte Team Trainerin. Ihre Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, resilient und psychisch gesund zu bleiben, vor allem in Zeiten von Krisen und hohen Anforderungen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, ein ganzes Team in stürmischen Zeiten so zu stärken, dass ein guter Zusammenhalt erhalten bleibt und die Zusammenarbeit gut gelingen kann. In ihren Trainings und Teamentwicklungen unterstützt sie seit mittlerweile 17 Jahren Unternehmen, Kliniken und die öffentliche Verwaltung.