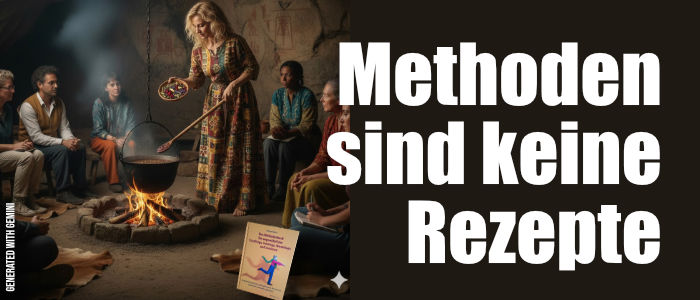Methoden sind wie Medizin oder Heilkunst. Da gibt’s einen Wirkstoff – also eine klare Idee, einen Inhalt, eine Intervention. Die soll etwas heilen, beruhigen, lösen oder stärken. Aber genauso wie eine Tablette nur dann wirkt, wenn sie zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosis und im richtigen Kontext eingenommen wird, wirken auch Methoden nicht einfach von selbst.
Ist es eine homöopathische Dosis oder eine schulmedizinisch hochwirksame Intervention? Im Coaching und Training ist es genau dasselbe: Wir haben eine Idee, einen Impuls, eine Erkenntnis – und die entscheidende Frage lautet: Wie bringe ich das in Resonanz mit der Gruppe oder der Einzelperson? Ist es eine stille Intervention oder eine laute? Eine körperliche, eine kognitive, eine provokative? Kommt sie direkt, indirekt, humorvoll, symbolisch, kreativ? Das Wesen der Methode liegt also nicht nur im Was, sondern vor allem im Wie. Und mehr noch: im Warum gerade jetzt, für wen, in welcher Dosis? Denn eines ist klar: Methoden sind keine Standardrezepte. Sie sind Handwerk, Kunst – und manchmal ein Ritt auf der Rasierklinge. Sie können scharf machen und zugleich auch verletzen. Manchmal könnte man sogar sagen: »Die Dosis macht das Gift«.
Was ist eigentlich eine Methode? Und was nicht?
Wenn wir über Methoden sprechen, werfen wir oft alle Begriffe in einen großen Topf: Intervention, Ritual, Zeremonie, Format … Alle diese Schlagworte werden gerne unter dem Oberbegriff »Methode« subsumiert. Doch das wäre, als würdest du Nudeln, Reis, Kartoffeln und Schokolade einfach nur als »Kohlenhydrate« bezeichnen – schmeckt am Ende nicht. Hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen.
1. Methode
Eine Methode ist ein strukturiertes Vorgehen, das auf ein Ziel ausgerichtet ist. Häufig ein Lern- oder Entwicklungsziel. Methoden sind in der Regel wiederholbar, nachvollziehbar und anwendungsbezogen. Sie geben Sicherheit und Struktur – für die Trainer ebenso wie für die Teilnehmenden. Aber: Methoden können auch erstarren. Wer nur auf das Ziel starrt, verliert manchmal das Hier und Jetzt – die Beziehung, die Stimmung, das, was sich gerade zeigt.
2. Intervention
»Intervention« kommt vom lateinischen »intervenire« (dazwischentreten, eingreifen, sich einmischen). Eine Intervention ist oft spontan. Sie greift in den Prozess ein, unterbricht, vertieft oder lenkt ihn um. Interventionen sind mutiger, manchmal irritierend, oft konfrontativ – aber immer mit dem Ziel, etwas in Bewegung zu bringen..
3. Ritual
Ein Ritual ist eine wiederkehrende Handlung mit symbolischem Gehalt. Es stiftet Sinn, markiert Übergänge, schafft Halt und Rhythmus. Anders als bei einer Methode steht das emotionale oder atmosphärische Erleben im Vordergrund, nicht das rein kognitive Ziel. Rituale verbinden uns mit etwas Größerem – mit uns selbst, mit anderen, mit der Gemeinschaft.
4. Zeremonie
Zeremonien sind Rituale mit besonderem Rahmen und häufig auch öffentlicher Bedeutung. Sie sind inszeniert – aber nicht künstlich. Eine Zeremonie hebt Bedeutung, schafft kollektives Bewusstsein und gibt großen Momenten eine würdige Form.
5. Format
Ein Format beschreibt den Rahmen, in dem eine Methode oder Intervention stattfindet. Coaching-Setting, Workshop, Aufstellung, Kreis, Paargespräch, Solo-Übung – alles Formate. Sie strukturieren das Wie: Wer spielt welche Rolle? Wie lange dauert es? Welche Regeln gelten?
Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
Weil wir als Coaches, Trainer, Wegbegleiter immer Gestalter von Resonanzräumen sind. Es macht einen Unterschied, ob ich eine Gruppe »durch ein Thema leite«, ob ich interveniere, weil etwas feststeckt, oder ob ich einen Moment ritualisiere, weil er größer ist als das Gespräch. Diese Begriffe helfen, das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit zu wählen. Oder sogar eigene Werkzeuge zu erfinden. Und dann – am Ende ist es auch wieder gleich, egal, denn wenn wir wissen, worum es tief im Prozess geht, wie es ins große Ganze passt, dann braucht es auch diese Titulierungen nicht. Dennoch helfen sie enorm beim Design, beim Erstellen der Dramaturgie .
Methoden wirken – und manchmal auch anders als geplant
Methoden haben Macht. Sie bewegen Menschen und rollen Themen aus, erzeugen Emotionen und bringen Erkenntnisse hervor. Methoden laden zum Austausch ein, zur inneren Beteiligung, zur Auseinandersetzung. Doch sie bergen auch Risiken. Methoden können:
- überfordern,
- Re-Traumatisierungen auslösen,
- Widerstand hervorrufen,
- Gruppendynamik ins Rutschen bringen,
- oder einfach nur eins tun: grandios scheitern,
- oder auch etwas ganz anderes.
Deshalb trägt, wer mit Methoden arbeitet, Verantwortung. Das Risiko liegt nicht darin, dass eine Methode nichts bewirkt – sondern dass sie mehr bewirkt, als du halten kannst. Für mich gibt es hier auch die Frage: »Wie viel Wirkung (im Sinne von Auswirkung) kann ich halten, wie die Verstörung einer Methode ausmacht. Und wenn es trotzdem knallt?
- Verantwortung übernehmen, nicht rechtfertigen.
- Nachbesprechen, was geschehen ist.
- Den Raum halten – auch wenn es unangenehm wird.
- Lernen – für die nächste Anwendung.
Manchmal ist es genau die verstörende Wirkung, die später zu einer echten Erkenntnis führt. Hier braucht es aus meiner Erfahrung genügend innere Ruhe und Contenance, um Sicherheit und Verlässlichkeit auszustrahlen.
Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären.
Friedrich Nietzsche

Barbara Messer, CSP, Horizonautin, international ausgezeichnete Rednerin, mehrfache Trainingspreisträgerin und Autorin von über 25 Büchern. Sie vereint Fachwissen (BBA, diverse Fachweiterbildungen, systemischer Coach, NLP-Trainer etc.) mit Herz (gelernte Altenpflegerin, Clown, Nia Brown Belt). Kleeblattfinderin, Tausendsassa, Visionärin, Mentorin für Transformation. Ihre Vielfalt inspiriert Menschen – klug, kreativ und grenzenlos.