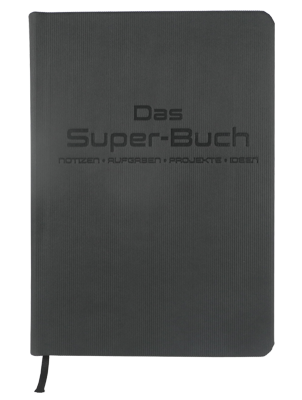„Ich muss souveräner werden, ich muss …, ich muss …“ wundervolle Erkenntnis. Genau betrachtet Floskeln, die Sie kein Stück voranbringen. Allerorts wird uns weisgemacht, dass wir mit solchen Wortstakkato eine grundlegende Verhaltensänderung einleiten können. Ein Irrglaube, denn mit dieser Herangehensweise verkommt der Wille zum Handeln zu leeren Worthülsen ohne Bezug, ohne Begründung, ohne Hintergrund. Es gilt zu hinterfragen und zu begründen, ob das augenscheinlich Erforderliche Sinn macht, ob es sich mit dem Grundsätzlichen oder dem Tatsächlichen in Einklang bringen lässt.
Nach wie vor ist das Ziel, mit der NBS zu einer authentischen Rhetorik zu gelangen. Nachdem der Anwender seine Ziele, Werte und Absichten bestimmt (Grundsätzliches) und genau betrachtet hat, wie er seine Rhetorik erlebt (Tatsächliches), ergeben sich schon fast automatisch die ersten Ideen zur Veränderung.
Prosa statt Rap
Wenn die Felder Grundsätzliches und Tatsächliches aneinander gehalten werden, könnte man den Satz: „Ich muss sicherer werden“ als Erforderlichkeit bestimmen. Das eben ist aber eine Floskel, die sich überhaupt nicht greifen lässt. „Uns wurde zu oft weiß gemacht, dass man alles kurz fassen muss. Das Ergebnis ist ein Wortstakkato, wodurch viele Dinge nicht mehr klar ausgedrückt werden, sondern stehen als Worte einfach nur da, ohne Bezug, Begründung und Hintergrund“, sagt Oliver Groß.
Das Feld Erforderliches bedarf eines genauen Überlegens und Abwägens und deshalb gilt auch hier, sich genügend Zeit zu lassen. Im Prinzip ergibt sich das Erforderliche aus der Abweichung, Widersprüchlichkeit und Diskrepanz zwischen dem Grundsätzlichen und dem Tatsächlichen. Doch wie gesagt, das darf nicht überhasstet geschehen, sonst kann es passieren, dass in diesem Feld Floskeln stehen, die kein Stück weiterhelfen.
In dem Wort Erforderliches stecken Begriffe wie Aufgaben und Maßnahmen. Es geht also darum, dass der Anwender jetzt Erforderlichkeiten be-stimmt, von denen er glaubt, dass sie ihn in seinem Vorhaben unterstützen. Dabei gibt es zwei Regeln zu beachten.
Der Anwender muss davon überzeugt sein,
- dass es ihm weiterhilft, bzw. dass die Maßnahme auch zur Lösung des Vorhabens geeignet ist.
- dass er auch diese ausführen möchte und kann.
Zunächst muss also klar sein, welche Erforderlichkeit (auch Maßnahme oder Aufgabe) jetzt weiter hilft und auch real umsetzbar ist. Wenn das bewusst ist, beginnt man die Maßnahme zu be-schreiben.
Um das genauer zu betrachten, nutzen wir die Beispiele aus den Berichten Teil II (Grundsätzliches) und Teil III (Tatsächliches).
Grundsätzliches: Mein Ziel ist, dass man mich als Redner akzeptiert, so wie ich bin, mit allen meinen Eigenschaften und Fähigkeiten. Besonders soll man meinen Praxisbezug akzeptieren und meine damit verbundene einfache Ausdrucksweise
Tatsächliches: Meinen letzten Vortrag fand ich persönlich recht gut, aber dann kamen die Fragen und die haben mich sehr oft aus dem Tritt gebracht, besonders dann, wenn ich keine schnellen Antworten parat hatte. Dabei wurde ich teilweise sehr schwammig in meinen Aussagen und wurde immer unsicherer.
Bevor also die Maßnahmen beschlossen werden, werden die beiden Schritte Grundsätzliches und Tatsächliches analysiert. Hier ist die Anwendung von Reflexionsfragen sehr sinnvoll, damit klar wird, welche Maßnahmen wirklich wichtig sind.
Reflexionsfrage 1: Welche Abweichung, Widersprüchlichkeit und Diskrepanz gibt es zwischen den Feldern Grundsätzliches und Tatsächliches?
Antwort z.B.: Während des Vortrags war eine Akzeptanz da, denn ich hatte ein gutes Gefühl und war sehr sicher. Erst bei der Fragerunde kam ich ins Straucheln.
Reflexionsfrage 2: Was hat mich aus dem Tritt gebracht – die Fragen oder die Tatsache, dass ich damit nicht zu Recht kam?
Antwort z.B.: Ich hatte das Gefühl, dass man mich testen oder aus der Reserve locken wollte!
Zieht man hier ein Resümee, ergibt sich ein sehr konkretes Bild.
- Der Anwender hat ein Erfolgserlebnis, denn der Vortrag war gut, er fühlte sich wohl und sicher.
- Der Anwender weiß jetzt, dass sein Vortragsstil seinem Wunsch (Grundsätzliches) sehr nah kommt und das bedeutet – weiter so.
- Er weiß aber auch, dass sein Problem in der direkten dialogischen Konfrontation nach dem Vortrag liegt.
- Vordergründig ist sein Problem zunächst ein Gefühl und eine Denkweise, nämlich, dass er sich vorstellt geprüft zu werden.
Aus diesen Fakten werden jetzt die Maßnahmen beschlossen.
Die aufgeführten Maßnahmen sind Beispiele, die als Lehransatz zu verstehen sind, d.h. jeder Anwender wird andere Schlüsse ziehen. Aus Erfahrung wissen wir auch, das diese dann noch konkreter und genauer sind. Erforderliches:
- Ich betrachte meinen Vortrag genau und schaue, welche Passagen mir besonders viel Sicherheit gegeben haben. Diese nutze ich, um Fragen und Antworten zu üben.
- Ich überdenke meine Einstellung zu meinen Zuhörern. Wie will ich sie in Zukunft sehen, auch trotz oder wegen meiner schlechten Erfahrung.
- Ich übe die „Genau-Fragen“, um klar zu stellen, dass ich mich nicht testen lasse und um Sicherheit und Souveränität zu erlangen. d)Um in der Frage- und Antwortsituation mehr Sicherheit zu bekommen, werde ich trainieren meine Fähigkeiten wie z.B. Praxisbeispiele, einfache Wortwahl und gute Beschreibungen stärker zu nutzen und Übung darin zu bekommen.
- Ich bereite mich in Zukunft auf die Fragerunde genauer vor und suche auf mögliche Einwände und Fragen gute praxisorientierte Beispiele für meine Antworten. Dabei überprüfe ich auch, welche Fragen ich mit Hilfe meiner Redestruktur beantworten kann – z.B. Verweis auf die jeweilige Passage.
- Die nächste Fragerunde werde ich zeitlich begrenzen und mit einer Struktur führen.
Diese Beispiele sind Ausschnitte aus der NBS, d.h. die Ausführlichkeit und die Anwendungsgebiete bieten weit aus mehr Möglichkeiten. Die Maßnahmen sind nun formuliert und damit die Umsetzung auch klappt, wird im nächsten Schritt „Mögliches“ erkundet, welche Möglichkeiten es gibt, die Maßnahmen auch in der Praxis umzusetzen. Mit dem Weg der kleinen Schritte ist zunächst Geduld gefordert.
Passt alles?
Wie schnell schwirren einem Gedanken durch den Kopf und man glaubt, schon alles durchdacht zu haben.
Im nächsten Schritt „Mögliches“ werden die Maßnahmen nochmals geprüft. In diesem oben beschriebenen Beispiel ist – als Anschauung – eine Maßnahme eingebaut, die sich im nächsten Schritt als untauglich erweist.
Die NBS ist keine Wunderschnellfeuerwaffe, sondern besticht durch ihre Gründlichkeit, was für manchen eine Herausforderung bedeutet. Sie ist auch ein Stück Entschleunigung!
Nächste Woche: Der 5. Schritt zur authentischen Rhetorik – Mögliches!

„Dann fahre ich die nächsten 40 Jahre auf demselben Gleis!“ Eine Erkenntnis, die Oliver Groß den Karriere-Kick brachte. Mit nur 22 Jahren wurde er Mitglied der Geschäftsleitung, übernahm Verantwortung für 350 Mitarbeiter und studierte nebenbei Kommunikationspsychologie und Philosophie. In dieser Zeit begann er auch, mit Notizbüchern zu experimentieren und stellte fest, dass diese unscheinbaren Helfer Großes bewirken: Sie helfen Lösungen und Auswege zu finden und eröffnen sogar ganz neue Perspektiven – die Geburtsstunde der NOTIZBUCH-STRATEGIE.