Sie haben es erfolgreich geschafft, einen positiven Kontakt zu Ihren Kunden aufzubauen und seine Neugier an Ihren Produkten und Leistungen zu wecken. Glückwunsch! Doch wenn Sie jetzt zu schnell zur Präsentation eines bestimmten Produktes oder zur Nennung eines bestimmten Preises übergehen, besteht die Gefahr, dass Sie dem Kunden etwas zeigen oder gar verkaufen, das nicht seinem Bedarf entspricht. Entweder kauft er es nicht, weil es nicht zu ihm passt, oder er bereut den Kauf im Nachhinein und zieht negative Schlussfolgerungen über Sie und Ihr Geschäft („Der hätte mich ein bisschen besser beraten sollen, dann wäre dieser Fehlkauf nicht passiert!“). Wenn der Kunde unzufrieden ist, ist er schnell bereit, zum Mitbewerber zu wechseln – und Ihnen geht damit wichtiges Umsatzpotenzial verloren.
Praxis-Tipp: Der Weg zum richtigen Verkauf – Step IV
Heute: Die Bedarfsermittlungsphase
Sie haben es erfolgreich geschafft, einen positiven Kontakt zu Ihren Kunden
aufzubauen und seine Neugier an Ihren Produkten und Leistungen zu wecken. Glückwunsch!
Doch wenn Sie jetzt zu schnell zur Präsentation eines bestimmten Produktes
oder zur Nennung eines bestimmten Preises übergehen, besteht die Gefahr,
dass Sie dem Kunden etwas zeigen oder gar verkaufen, das nicht seinem Bedarf
entspricht. Entweder kauft er es nicht, weil es nicht zu ihm passt, oder er
bereut den Kauf im Nachhinein und zieht negative Schlussfolgerungen über
Sie und Ihr Geschäft („Der hätte mich ein bisschen besser beraten
sollen, dann wäre dieser Fehlkauf nicht passiert!“). Wenn der Kunde
unzufrieden ist, ist er schnell bereit, zum Mitbewerber zu wechseln – und Ihnen
geht damit wichtiges Umsatzpotenzial verloren.
Bevor es um ein bestimmtes Kaufobjekt oder einen genauen Preis geht, sollten
daher die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden im Vordergrund stehen.
Wenn er den Eindruck hat, ein bestimmtes Produkt passt zu ihm und bringt ihm
den gewünschten Nutzen, ist er auch offen für einen Kauf. Deshalb
wird die Kostenfrage in vielen Fällen ganz an den Schluss des Verkaufsgesprächs
gesetzt. Wenn Sie als Einstieg sofort nach den Preisvorstellungen des Kunden
fragen, schränken Sie ihn in der Auswahl eines passenden Produkts nur unnötig
ein.
Beispiel:
Ein Kunde betritt eine Weinhandlung. Er gibt an, wenig von Wein zu verstehen,
aber ein passendes Geschenk für einen guten Kunden zu suchen. Er suche
einen trockenen, sehr guten Rotwein. „Welche Preisvorstellung haben Sie?“,
fragt die Verkäuferin. „So um die fünfzig Euro hatte ich gedacht“,
antwortet der Kunde. Die Verkäuferin: „Ach, das ist schade, da kommen
eine ganze Reihe von hochwertigen Sorten schon mal nicht in Frage.“
Außerdem ist es wichtig, dass Sie sich auf jeden Kunden neu einlassen
und ihn individuell betreuen. Was dem einen gefällt, muss für den
anderen noch lange nicht passen. Verkneifen Sie sich also Anmerkungen wie: „Dieses
Produkt ist bei unseren Kunden das beliebteste.“ Insbesondere in der Modebranche
ist der Wunsch nach Individualität hoch und sollte berücksichtigt
werden. Äußerungen wie: „Dieses Kleid habe ich gestern gerade
erst einer anderen Dame verkauft“ sind daher ein schwer wiegender Fehler.
Ein weiterer Fehler, den viele Verkäufer gerade in der Bedarfsermittlungsphase
machen, ist das Vorschlagen von Produkten, die ihnen selbst gut gefallen, aber
stark vom Geschmack des Kunden abweichen. Wenn Sie einer Kundin in schwarzem
Lederoutfit ein Blümchenkleid vorschlagen, das Ihnen selbst gut gefällt,
ist die Ablehnung vorprogrammiert und die Kundin fühlt sich schlecht beraten.
Um solche Fehlgriffe zu vermeiden, ist eine gute Kommunikation mit dem Kunden
erforderlich. Nur wenn Sie wissen, welche Anforderungen der Kunden an ein Produkt
stellt, können Sie ihm eine geeignete Auswahl präsentieren. Stellen
Sie dem Kunden daher Fragen, um seine Kaufmotive zu erfahren.
Eine offene Frage überlässt es dem anderen, wie er sie beantwortet.
Eine geschlossene Frage bietet drei Antwortmöglichkeiten: Ja, nein und
vielleicht. Die Chance, eine ehrliche Antwort zu bekommen, ist bei einer offenen
Frage am größten. Lassen Sie eine Pause nach jeder Frage, damit Ihr
Kunde nachdenken und antworten kann. Eine wichtige Frage, um Informationen über
die Kaufmotive und Wünsche des Kunden zu bekommen, ist:
„Was erwarten Sie von einem
?“
Weitere offene Fragen:
- „Was meinen Sie mit ?“
- „Wie wichtig ist Ihnen ?“
- „Was bedeutet für Sie ?“
- „Was halten Sie von ?“
- „Worum geht es Ihnen, wenn ?“
Durch die Beantwortung Ihrer Fragen wird dem Kunden sein eigenes Kaufmotiv
bewusst, der Wunsch nach dem Produkt wird damit stärker.
Fragetechniken
Suggestivfragen:
Sie werden häufig im Verkauf eingesetzt. In diesen Fragen versteckt der
Verkäufer eine bestimmte Meinung und drängt den Kunden durch die Formulierung,
diese zu bejahen: „Ist das nicht ein wunderschönes Design?“ „Das
ist doch wirklich ein schicker Anzug, finden Sie nicht?“
Die Wirkung von Suggestivfragen ist jedoch zweifelhaft. Der Kunde mag Suggestivfragen
zwar bejahen, das heißt aber noch nicht, dass er auch zustimmt. Er sagt
also „ja“, denkt aber „nein“. Daher ist von platten Suggestivfragen
im Verkaufgespräch abzuraten. Sie bergen zudem das Risiko, dass der Kunde
negative Schlussfolgerungen über Sie als Verkäufer zieht, beispielsweise:
„Der will mir nur etwas aufschwatzen.“
Alternativfragen:
Diese können sowohl als Manipulationsinstrument als auch zum Zweck der
gezielten Informationsermittlung eingesetzt werden. Zum unfairen Manipulationsinstrument
wird die Alternativfrage durch folgenden Einsatz: Der Verkäufer setzt die
positive Verkaufsentscheidung des Kunden voraus und stellt in diesem Zusammenhang
zwei Alternativen zur Wahl – „Möchten Sie das Modell in Variante A
oder in Variante B?“ Die dritte Alternative, nämlich die Entscheidung
gegen einen Kauf, wird bewusst nicht angesprochen. Der Kunde soll also durch
die Alternativfrage in Richtung Kauf gedrängt werden und das falsche Gefühl
bekommen, er steuere den Prozess und treffe eine echte Wahl.
Sensible und intelligente Kunden durchschauen dieses Manöver jedoch schnell
und regieren mit Ablehnung. Deshalb ist vom Einsatz der Alternativfrage als
Manipulationstechnik dringend abzuraten, denn oft erreichen Sie damit das Gegenteil
des Erhofften: Der Kunde lehnt einen Kauf kategorisch ab. Die Alternativfrage
ist also nur dann sinnvoll, wenn der Kunde direkt nach Alternativen fragt oder
ein ernsthaftes Interesse an verschiedenen Varianten bekundet.
Aktives Zuhören
Diese Technik ist besonders gut dazu geeignet, um Informationen zu ermitteln.
Ursprünglich kommt die Methode aus der Psychotherapie. Um dem Klienten eine
bessere Hilfe zur Selbsthilfe geben zu können, beschränkt sich der Therapeut
zunächst auf ein aktives, akzeptierendes Zuhören, ohne die Aussagen
zu bewerten oder zu kommentieren.
Gerade im Bereich hochpreisiger Produkte bieten Sie Ihren Kunden einen Service,
der über den normalen Standard hinausreicht. Dazu kann auch gehören,
dass Sie sich bei einem entsprechenden Kunden intensiver auf ihn als Menschen
einlassen. Sie können die Technik des aktiven Zuhörens nutzen, um Ihre
Kunden besser kennen zu lernen. Aktives Zuhören ermutigt Ihren Kunden, über
seine Wünschen und Bedenken in Zusammenhang mit dem Kaufvorhaben zu sprechen.
Wenn er sich von Ihnen verstanden und akzeptiert fühlt, wird er Ihnen Sympathie
entgegen bringen und Sie als kompetent empfinden. Aber auch beim aktiven Zuhören
kommt es auf die richtige Dosierung an. Der Kunde darf nicht den Eindruck bekommen,
er habe es mit einem Papagei zu tun. Zum andern muss Ihre Köpersprache zum
aktiven Zuhören passen. Wenden Sie sich dem Kunden freundlich und offen zu.
Halten Sie Blickkontakt zu ihm und nicken Sie von Zeit zu Zeit bestätigend.
Wege des aktiven Zuhörens:
Wiederholen Sie ein emotional besetztes Wort des Kunden aus seinem letzten Satz.
Fassen Sie das vom Kunden gesagte noch einmal in eigenen Worten zusammen.
Übung zum aktiven Zuhören: Lassen Sie sich von einer nahe stehenden
Person ein Erlebnis oder ein Ereignis erzählen. Versuchen Sie, sich möglichst
gut auf Ihr Gegenüber zu konzentrieren und sich in Ihren Gesprächspartner
hinein zu versetzen. Nach ungefähr jedem dritten Satz fassen Sie das Gehörte
in eigenen Worten zusammen. Anschließend soll Ihr Übungspartner Ihnen
mitteilen, wie gut er sich von Ihnen verstanden gefühlt hat.
Die Gegenfrage
Manchmal kann es passieren, dass der Kunden Ihnen eine Frage stellt, die Sie
selbst nicht beantworten können oder wollen. Eine gute Möglichkeit,
um Zeit zu gewinnen und den Ball wieder an den anderen zurück zu spielen,
ist die Gegenfrage. Sie kann auch eingesetzt werden, um für eine genaue
Antwort noch weitere Informationen vom Gegenüber zu erhalten. Doch kommt
es bei der Gegenfrage auf die grammatikalische Struktur an. Stellen Sie als
Gegenfrage immer eine offene Frage, die das Gegenüber ausführlich
beantworten muss.
Beispiel
Kunde: „Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich mich für die neueste
Ausführung interessiere. Warum haben Sie mir bisher nicht gesagt, dass
in zwei Wochen ein komplett neues Model auf den Markt kommt?“
Ihre Gegenfrage: „Woher haben Sie Ihre Informationen?“
Überprüfen Sie bei jeder Gegenfrage, ob es wirklich eine offene Frage
ist, die man nicht mit „Ja“, „Nein“ oder „Vielleicht“
beantworten kann. Sie können die Gegenfrage-Technik auch mit einem Partner
trainieren, der Ihnen unangenehme Fragen stelle. Achten Sie bei der Gesprächsführung
darauf, nicht zu oft mit einer Gegenfrage zu antworten, sonst gerät der
Dialog ins Stocken und Sie wirken unhöflich. Außerdem ist es wichtig,
eine „weiche“ und unsachliche Gegenfrage zu stellen („Woher haben
Sie diese Information?“), statt eine aggressive, wie z.B.: „Was hat
diese Frage mit unserem Gesprächsthema zu tun?“ Der Kunde soll sich
durch Ihre Gegenfrage ja nicht angegriffen fühlen.
Unklare Aussagen des Kunden klären
Eine von Kommunikationsfachleuten entwickelte Redensart lautet:
Gesagt ist nicht gehört,
gehört ist nicht verstanden,
verstanden ist nicht einverstanden,
einverstanden ist nicht umgesetzt.
Nicht immer bekommen Sie auf eine Frage eine klare Aussage des Kunden, die
einen Rückschluss auf seine Kaufmotive und seine genauen Vorstellungen
über das Produkt zulässt. Da helfen nur weitere Fragen.
Kunde: „Ich möchte mir eventuell einen neuen Schreibtisch für
mein Arbeitszimmer kaufen.“
Unklare Komponenten: „möchte eventuell“ und „neuer Schreibtisch“
Mögliche Nachfragen: „Was spricht dagegen, sich einen neuen Schreibtisch
zu gönnen?“, „Wie haben Sie Ihr Arbeitszimmer eingerichtet?“,
„Welche konkreten Vorstellungen haben Sie?“
Notieren Sie bei Bedarf die Antwort des Kunden und übernehmen Sie seine
Formulierungen später ins Angebot auf (falls der Kauf nicht vor Ort getätigt
wird). Vergewissern Sie sich zwischendurch immer wieder, dass Sie den Kunden
auch richtig verstanden haben (und er Sie)!
Die Bedarfsermittlung ist zu Ende, wenn Sie wissen, welche praktischen Anforderungen
Ihr Kunde an sein Wunschprodukt hat und welchen immateriellen Wert er sich davon
erhofft. Fassen Sie seine Antworten zusammen, vergewissern Sie sich, dass Sie
ihn richtig verstanden haben und präsentieren Sie ihm dann mindestens ein
Produkt, das diese Merkmale erfüllt und das zu ihm passt. Beobachten Sie
jetzt seine Reaktionen genau, denn es geht für den Kunden und für
Sie um sehr viel Geld. Sie werden an seiner Körpersprache und an seinen
Äußerungen erkennen, in welcher Weise noch Überzeugungsbedarf
besteht. Damit leiten Sie das Gespräch dann in die nächste Phase über:
Die Überzeugungsphase.
Mehr dazu im nächsten Newsletter. Dort geht es dann weiter mit Step VI:
Die Überzeugungsphase.
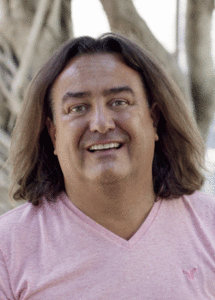
Stéphane Etrillard zählt zu den meistgefragten Wirtschaftstrainern und Business-Coaches. Als Experte für persönliche Souveränität und Unternehmersouveränität ist er Autor von über 40 Büchern. Sein einzigartiges Know-how ist in den letzten 20 Jahren in der Begleitung von über 25.000 Unternehmern und Managern entstanden. Seine Unternehmercoachings wenden sich an Unternehmer, die erfolgreich werden und bleiben wollen und vor allem mit Leistungen am Markt auftreten wollen, die auch gekauft werden.

