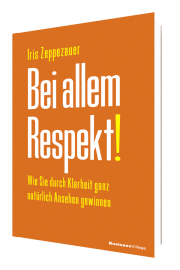Um Respekt zu erhalten, müssen wir etwas tun. Wir können mit Machtspielen Unsicherheit und Misstrauen aufbauen, um so aus der Angst unserer Mitmenschen Respekt zu generieren. Diese Art des Respektes führt zu negativen Auswirkungen bis hin zu Kränkung oder Hass. Oder wir bauen positiven Respekt auf, dessen Nährboden Wertschätzung und Achtung ist.
In der Kommunikation stehen uns zum Aufbau von Respekt und Ansehen vier verschiedene Sprachen zur Verfügung. Nur eine davon ist die Wortsprache (verbal), alle anderen sind ohne Worte (nonverbal).
Die Wortsprache
Beginnen wir bei der Wortsprache, denn sie verfügt über immense Macht. Stellen Sie sich vor, Sie möchten, dass Ihre bessere Hälfte zu Hause den Müll nach draußen bringt. Wie formulieren Sie üblicherweise diesen Wunsch?
a) »Würdest du bitte den Müll rausbringen?«
b) »Möchtest du gerne den Müll rausbringen?«
c) »Heute könntest du einmal den Müll rausbringen.«
d) »Wenn du mich wirklich liebst, siehst du, wie du mir helfen kannst.«
e) »Bitte bring den Müll raus.«
Wenn Sie jetzt schmunzeln, verstehe ich das. Die meisten entdecken sich ganz klar in einer dieser Formulierungen. Und die wenigsten formulieren nach Beispiel E. Das gleiche gilt, wenn wir mit unseren Kindern sprechen. Wir sagen »Möchtest du den Tisch decken?« und sind enttäuscht, wenn das Kind Nein sagt. Dabei war die Frage für das Kind eine Entscheidungsfrage und es hat noch nicht verstanden, dass es in Wahrheit keine Entscheidung gibt, sondern Sie sich Hilfe erwarten. Wenn Sie jetzt sauer sind, stiften Sie zusätzlich Verwirrung. Keine gute Grundlage für eine gesunde Beziehung.
Im Berufsleben passiert es uns täglich: Kunden, Kolleginnen, Vorgesetzte äußern Ihre Wünsche in den unterschiedlichsten Formen – je nach Verhaltenstypus und emotionaler Verfassung. Dialektisch gesehen können Sie sich immer aussuchen, welchen Aspekt der Botschaft Sie behandeln. Wenn Ihnen Ihre Vorgesetzte ein Dokument auf den Tisch knallt und Sie anfährt: »Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht?«, dann können Sie wählen, wie Sie reagieren.
a) Sie sprechen die Emotion an: »Ich sehe, Sie sind sehr aufgebracht, was ist denn passiert?«
b) Sie sprechen die Sache an: »Worum geht es denn, bitte?«
c) Sie rechtfertigen sich: »Ich versuche doch nur, gute Arbeit zu leisten!«
d) Sie reagieren zynisch: »Das könnte vielleicht an unklaren Anweisungen liegen.«
e) Sie schießen scharf zurück: »Jetzt beruhigen Sie sich mal, und dann reden Sie höflich mit mir.«
Das gesprochene Wort entscheidet maßgeblich über den Verlauf des Gespräches, über Ihre Beziehung zur anderen Person und über das Resultat. Wir alle kennen Situationen, in denen wir bereits im Vorfeld einschätzen können, was bei welcher Reaktion passiert. Gehen wir bewusst damit um!
Die Körpersprache
Die nonverbalen Aspekte. Unsere Körpersprache zeigt dem anderen, wie wir wirklich empfinden. Decken sich die beiden Ebenen, also Wort- und Körpersprache nicht, so stiften wir Verwirrung. Im Gegenüber entsteht eine sogenannte kognitive Dissonanz, es kann nicht mehr zuordnen, wie die Botschaft gemeint ist. Wenn mein Mann mich fragt, wie es mir geht, so verrate ich mit meiner Antwort nicht nur das. Ich zeige ihm zudem noch, wie ich zu ihm stehe, was ich wirklich fühle und was ich eigentlich möchte. Meine Antwort wird von meiner Körpersprache getragen. Dazu zählen meine Stimme, der Tonfall, meine Haltung und meine Gesten.
Die Symbolsprache
Doch Wort- und Körpersprache sind nicht die einzigen Möglichkeiten, in unserer Kommunikation Respekt aufzubauen. Unser Gegenüber nimmt den größten Teil der Informationen zuerst mit dem Auge auf und fällt ein Urteil, mit wem es zu tun hat. Deshalb dürfen wir unsere Symbolsprache niemals unterschätzen. Welche Kleidung, welchen Schmuck, welche Accessoires tragen wir? Welche Frisur haben wir gewählt und ist das Gesamtbild gepflegt? Die Symbolsprache muss die inhaltliche Botschaft unterstreichen, sonst entsteht Dissonanz. Möchten Sie hochwertige Produkte verkaufen und verwenden im Verkaufsgespräch abgegriffene Broschüren und billige Schreibgeräte, haben Sie schlechte Karten, den Zuschlag zu erhalten. So ging es vor einiger Zeit einem Autoverkäufer, als ich mich für ein Auto interessierte und eine Probefahrt im Autohaus vereinbarte. Der Verkäufer bot mir einen Platz unter einem kahlen, verwahrlosten Gummibaum in seiner unaufgeräumten Verkaufskoje an. Zuvor hatte er noch eine Zigarette geraucht, das war nicht zu überriechen. Auf dem Tisch waren noch die Kaffeeränder einer abgestellten Tasse – inmitten unzähliger Fingerabdrücke, die das Sonnenlicht auf der Glasplatte so richtig zur Geltung brachte. Die Qualität der Gesprächsführung war eine Fortsetzung der Symbolsprache: unvorbereitet und unstrukturiert. Kurzum: Nichts passte zu dem Produkt, das als hochwertig, zuverlässig und Premium gelten sollte.
Die Besitzsprache
Sehen wir uns noch die vierte Ausdrucksform in unserer Kommunikation an, die Besitzsprache. Nichts löst so viel Diskussion aus wie Besitz, schließlich steht er für den Verteilungsaspekt unserer Gesellschaft und bildet somit neben persönlichen Aspekten wie Aussehen und Intelligenz die Basis für Neid. Das bedeutet gleichzeitig, dass es als erstrebenswert gilt, etwas zu besitzen – es bringt Status: Ich habe etwas, das du nicht hast. Die Besitzsprache äußert sich über Immobilien, Güter, Zeit und Raum. Hochwertige Immobilien in gefragter Lage zu besitzen, ist für viele das Statussymbol schlechthin. Man kommt nicht umhin, Firmen nach ihrer Lage zu beurteilen. So macht es einen Unterschied, ob Sie über ein erstklassiges Gebäude oder Büro in einer schicken Gegend verfügen, oder ob Ihre Adresse an einem unbeliebten Ort liegt – vorausgesetzt, Sie benötigen überhaupt eine Immobilie für Ihr Business. Neue Geschäftsmodelle funktionieren zunehmend rein virtuell und haben als Firmensitz eine Postadresse. Besitzsprache kann auch anders ausgedrückt werden, zum Beispiel in Form von Humankapital: »Für XY arbeiten bereits zweitausend Menschen!« Auf Social-Media-Plattformen sehen wir zudem eine ganz spezielle Art der Besitzsprache, die vor allem junge Menschen ansprechen soll: Fette Luxusautos, teure Uhren, hochangesagte Modelabels werden von attraktiven Influencern präsentiert – mit der gleichzeitigen Werbebotschaft: »Du kannst das auch schaffen!«
Besitzsprache im Kontext mit Respekt äußert sich aber noch viel alltäglicher. So zählen Zeit und Raum zu verteilbaren Gütern. Wer sich mehr nimmt, lässt den anderen weniger. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie bei Ärzten, Anwälten, hochgestellten Persönlichkeiten oder Vorgesetzten immer warten müssen? Der König nimmt sich die Zeit, hieß es schon in alten Tagen. Von Ihnen hingegen wird Pünktlichkeit erwartet – so werden Sie zum Höfling und Bittsteller. Das ist Machtspiel par excellence. Im Raum erkennen wir ein ähnliches Bild: Manche Menschen nehmen sich selbstverständlich mehr davon. Sie breiten sich am Besprechungstisch aus, sprechen lauter, öfter und länger als andere. Ihre Gesten sind groß und selbstbewusst. Im Extremfall sind sie so dominant, dass sie anderen sprichwörtlich die Luft zum Atmen nehmen.
Drei Tipps für mehr Respekt
#1 Respekt entsteht über unsere Kommunikation, über das, was wir ausdrücken. Das meiste geschieht im unbewussten Bereich. Menschen haben unterschiedliche Verhaltensmuster, sie sind unterschiedlich sozialisiert und haben individuelle Ängste und Ansprüche.
#2 Die Wortsprache ist nur eine der vielen Ausdrucksweisen, über die wir Respekt aufbauen. Vieles passiert nonverbal, durch Körper-, Symbol- oder Besitzsprache.
#3 Wer bewusst beobachtet, kann die Sprachkanäle entdecken und sie sich zunutze machen. Ziel sollte immer Klarheit sein, indem wir die Ausdrucksweisen aufeinander abstimmen. Denn wenn das, was andere sehen und wahrnehmen nicht mit der gesprochenen Botschaft übereinstimmt, verlieren wir Aufmerksamkeit und Respekt.

Iris Zeppezauer steht für exzellente Kommunikation im Business. Sie ist Wissenschaftlerin, Hochschuldozentin und Beraterin. Seit über zehn Jahren coacht sie Persönlichkeiten, die in jeder Situation ihre Meinung klar, aber wertschätzend transportieren müssen.