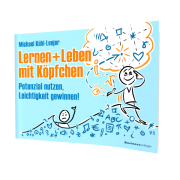Das Lernen in der Schule wird oft als »Bulimielernen« abgetan. Die Argumente sind bekannt: Man braucht es nie wieder, weil man alles googeln kann – und Wissen veraltet ohnehin viel zu schnell. Doch der wahre Zweck des Lernens hat nichts mit Inhalten oder Spaß zu tun. Es geht um etwas viel Größeres…
Die ganze Diskussion geht am Prozess des Lernens vorbei.
Denn in der Schule geht es nicht primär um das Auswendiglernen von Fakten, sondern um das Erlernen von Denkprozessen.
Der oft bemühte »Spaß beim Lernen« ist ein Irrweg. Denn Lernfrust entsteht in der Regel, wenn wir an die Grenzen unseres bisherigen Wissens stoßen. Er ist ein Signal dafür, dass wir uns nicht mehr im bequemen, bekannten Bereich bewegen, sondern in die sogenannte Lernzone eintreten. Ohne diesen Widerstand würden wir nur Bekanntes wiederholen und uns nicht weiterentwickeln. Er ist das notwendige Unbehagen, das dem Wachstum vorangeht. Aus der Perspektive der Negativen Psychologie (Prof. Dr. Dr. Oliver Hoffmann https://lnkd.in/ef3r8BDC Negative Psychologie) ist Lernfrust eine Chance, unsere mentale Stärke, unsere Kreativität und unsere Problemlösefähigkeit zu trainieren.
Vernetztes Denken
Wenn wir neues Wissen an bestehendes andocken, entsteht ein komplexes neuronales Netzwerk. Das Lernen von Geschichte befähigt uns beispielsweise, aktuelle politische Entwicklungen besser zu verstehen und zu beurteilen. Mathematik lehrt logisches und strukturiertes Denken, das in fast jedem Beruf und in jeder Alltagssituation nützlich ist. Es geht also darum, wie verschiedene Disziplinen miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen.
Metakognition
Metakognition bedeutet, über das eigene Denken nachzudenken. Schüler lernen nicht nur, was sie lernen, sondern auch wie sie lernen. Das Erkennen eigener Lernstrategien, Schwächen und Stärken befähigt sie, zukünftige Lernprozesse selbstständig zu gestalten. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die sie in der Schule erwerben können, wir unser ganzes Leben lang benötigen.
Problemlösungskompetenz
Die Schule konfrontiert Schüler mit unterschiedlichen Problemen, die sie mithilfe des Gelernten lösen sollen. Sei es eine physikalische Gleichung, ein historischer Konflikt oder eine komplexe Textanalyse – das Ziel besteht darin, die Fähigkeit zu entwickeln, Probleme strukturiert zu erfassen und passende Lösungswege zu finden. Diese universelle Kompetenz ist auf alle Lebens- und Berufsbereiche übertragbar.
Von der Frustration zur Resilienz
Wer lernt, sich durch komplexe Themen zu kämpfen und dabei auch mit Misserfolgen umzugehen, entwickelt mentale Widerstandsfähigkeit. Die Erfahrung, dass man durch Anstrengung und Beharrlichkeit schwierige Aufgaben bewältigen kann, stärkt das Selbstvertrauen. Diese Resilienz ist im Berufs- und Privatleben unerlässlich.
Dieser Beitrag erschien kürzlich auf unserem LinkedIn Kanal und hat eine mächtige Resonanz und auch Kontroverse hervorgerufen, die immer noch anhält. Schaut euch die hitzige Debatte an und sagt uns, was ihr denkt! LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7372875506528174080

Michael Kühl-Lenjer verknüpft langjährige Vertriebs-, Führungs- und Trainingserfahrungen mit aktuellen Erkenntnissen der Gehirnforschung. Als Business-Trainer und Kommunikationsberater unterstützt er Unternehmen und Ausbildungsinstitute dabei, neurowissenschaftliche Aspekte in ihre Aus- und Weiterbildung einfließen zu lassen. Michael Kühl-Lenjer ist Mitglied in der Akademie für neurowissenschaftliches Bildungsmanagement (AFNB) und bezieht seine neurobiologischen Kenntnisse direkt von Wissenschaftlern.