Erinnern Sie sich noch an die „Nieten in Nadelstreifen“? Das war Auftakt zum Chefbashing. Führungskräfte galten per se als inkompetent. Der neue Schlachtruf heißt hingegen „Die Führungskraft als Coach“. Die „inkompetenten Nieten“ sollen psychologisch denken und Mitarbeitern nach psychologischen Kenntnissen führen – ganzheitlich, versteht sich. Und die Verwandlung von der Niete zum weißen Ritter nimmt zunehmend an Fahrt auf …
Das tun sie noch immer: „Wenn der Chef ein Idiot ist“, besteht Bedarf nach Identifikation eines Schuldigen. Und der ist rasch gefunden: „Viele Vorgesetzte sind eine Zumutung“?; denn bedauerlicherweise werden Fachleute zu Führenden, lernen das Führen nicht, benutzen erfolgreich „Ellbogen, Egoismus und Machtstreben“, entbehren der „Eigenschaften, die man für den Karrieresprung braucht“, und können daher weder „souveräne Persönlichkeit“ noch „der ideale Chef“ sein?. Dort sind Vorgesetzte Idioten, hier sind sie „dümmlich“?: Tobias Schormann ironisiert „die dümmliche Führungskraft“, die „sensibler“ sei, als man denke, und gibt den Mitarbeitern Tipps, wie sie „Acht grobe Fehler im Umgang mit dem Chef“ vermeiden können.
Verächtliches Beschimpfen genügt nicht. Psychologie muss her. Führungskräfte sind nicht nur dumm, sondern auch psychisch gestört oder krank. Etwa: „Narzisstische Menschen werden oft Führungskräfte, ohne besonders geeignet zu sein.“? und: „Wahnsinns-Typen. Psychopathen“?. Psychopathologisierung ist „in“. Anscheinend ist es chic, Führungspersonen mit psychologischen Etiketten zu bewerfen und sie zu neurotischen, psychotischen, krankhaften Spinnern zu machen, die Unheil anrichten. Dem fügt sich auch der Hinweis darauf, dass Führende nahezu notwendig an einer narzisstischen Störung erkranken – und Mitarbeitende und Unternehmen darunter leiden: „Ich, das Genie“ als Formel für „Selbstüberschätzung“ und diese wiederum als „Berufskrankheit Nr. 1 bei Managern“?.
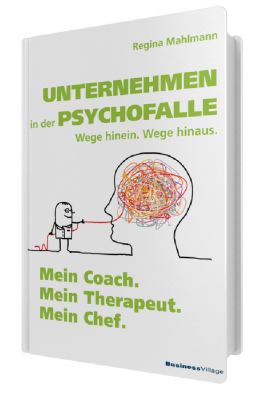
Beschimpfen und Psychopathologisieren reicht nicht. Die Beleidigung kommt hinzu: Führende werden oft als Alpha-Tiere bezeichnet – häufig in Begleitung von Abbildungen, die Affen (Gorillas, Schimpansen) zeigen. Gibt man das Stichwort in die Suchmaschine ein, ergibt das tausende von Treffern. Zu den Favoriten zählen Wirtschaftsleute, Fußballer, Schauspieler, Künstler, Politiker. Ein Blog zu diesem Thema umfasst einige zig Seiten und gibt Aufschluss darüber, inwiefern und wo menschliche Alpha-Tiere als unvermeidlich, hilfreich, nötig oder als sozialdarwinistisches Ergebnis von Kämpfen, als peinlich, überflüssig, destruktiv, be- und verhindernd gelten?
Publikumswirksam benutzt werden die Etiketten Narzisst und Alpha-Tier in ihrer abwertenden Bedeutung. Wissenschaftliche Forschung indes zeigt, dass sowohl Narzissmus als auch Alpha-Tier-Aspekte konstruktive Seiten haben. Um diese zu entdecken, muss man auf zweierlei schauen: auf den Führungskontext und auf die Stoßrichtung. Sobald sie das Unternehmen und seinen Erfolg exponieren (und nicht Mitarbeitende), gelten bestimmte Bereitschaften, Präferenzen und Fertigkeiten beider Persönlichkeitstypen bzw. -züge als willkommen.
Kurze Popularität haben die Ausführungen von Kate Ludeman und Eddie Erlandson erreicht?. Sie stellen vier Alpha-Mann-Typen vor. Zunächst werden die Stärken hervorgehoben und danach wird erläutert, wann die Stärken in destruktive Schwächen umschlagen. Außerdem überlegen die Autoren, was die Alphas selbst und deren Partner tun können, um das Destruktive in Konstruktives umzuwandeln beziehungsweise das kontraproduktive Moment einer Stärke zu vermeiden. Alpha-Manager erscheinen allerdings auch hier sozial wenig kompetent und benötigen zur Korrektur Nicht-Alphas als Lehrmeister.
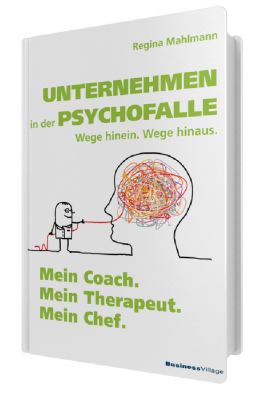
Dass auch Narzissmus Wirkungsbereiche hat, in denen er förderlich sein kann, zeigt eine interdisziplinäre Studie der Universität Hohenheim, der Hochschule Reutlingen und der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster?. Untersucht wurde der Einfluss der sogenannten „Dunklen Triade der Persönlichkeit“ in der Phase vor der Unternehmensgründung. Dabei schnitten Narzissten, als „selbstverliebte Persönlichkeiten“ bezeichnet, insofern gut ab, als ihnen offenbar eine höhere Neigung zu eigen ist, Unternehmen zu gründen. „Hochwertige Businesspläne stammen dagegen eher aus der Feder von Machiavellisten.“ Die Studie wurde im Rahmen der Jahreskonferenz der British Academy of Management (BAM) mit dem Best Paper Award ausgezeichnet. Hauptergebnis: „Narzissmuss, Machtstreben & Co scheinen Existenzgründern zu helfen, zumindest in der Anfangsphase bis zum Erfolg“. Interdependenzen von Narzissmus und Führung(serfolg) wurden immer wieder erforscht?.
Gegenwärtig überwiegen Negativzuschreibungen: Führungskräfte sind demnach wandelnde Inkompetenz, Idiotie, Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie.
Das ist aber noch nicht der Gipfel!
Der neueste Schrei verwandelt Führende in einen Virus: Führende machen – so die naive monokausale Logik – Mitarbeitende krank: „Chef-Nieten gehen aufs Herz“?; oder – die scheinbar konstruktivere Variante derselben Botschaft: „Burnout: Vorgesetzte können psychische Belastung der Mitarbeiter reduzieren“. Führende werden verpflichtet, fürsorglich zu sein, indem sie „ihre Mitarbeiter bei der Arbeit sozial unterstützen“. Das allerdings müssen sie auf Dauer tun: „Beenden oder unterbrechen die Vorgesetzten ihre Unterstützung jedoch, steigen die durch Burnout bedingten Ausfälle in der Belegschaft schnell wieder auf den vorherigen Stand.“ Im Februar 2011 kommt eine Umfrage zu diesem Ergebnis: „den Chefs gelingt es nicht, die psychische Beanspruchung ihrer Mitarbeiter zu erkennen oder angemessen darauf zu reagieren.“? Zwar „(spielen) Führungskräfte eine Schlüsselrolle“, aber sie versagen in der „ganzheitlichen Gefährdungsbeurteilung“?. Und – siehe oben – unter ganzheitlich wird verstanden: Körper, Seele, Geist, soziales Miteinander und weitere Kontextvariablen wie Handlungsspielräume und Umgebung (Branche, Unternehmen, Arbeitsplatz, Infrastruktur).
Fazit: Bis auf die offenkundigen Abwertungen zeichnen sich Negativ-Wertungen dadurch aus, dass sie einem psychologischen Diskurs entspringen. Insofern sind Führungskräfte bereits selbst psychologisiert: Empfänger psychologischer Labels. Die konkreten, gerade besprochenen Etikettierungen exkulpieren Führende allerdings nicht. Vielmehr – und das ist erstaunlich – sollen sie ihrerseits psychologisch denken und ihre Mitarbeitenden nach psychologischen Kenntnissen führen – „ganzheitlich“, versteht sich.
Die Verwandlung von der Niete zum Weißen Ritter kommt in Fahrt.
Die Inkompetenten sollen’s richten
Bemerkenswerterweise dienen also gerade jene Funktions- und Rollenträger als Projektionsfläche für psychologische Empfehlungen und Anweisungen, die verunglimpft werden. Die Inkompetenten als Retter. Wie kann das sein?
An dieser Stelle eine Kurzantwort, exemplifiziert am gegenwärtig inflationär bemühten „Syndrom“ Burnout. Warum? Weil in diesem Zusammenhang meines Wissens erstmalig gefragt wird, ob Führungskräfte psychotherapeutisch und psychiatrisch (!) geschult werden sollten.
Wer verantwortlich ist, muss entsprechend handeln. Das ist eine Art Glaubenssatz, der mehr oder minder ausdrücklich der Ansatzpunkt für viele Zumutungen an Führungskräfte ist. Wer diese facettenreiche Überzeugung teilt, teilt die Auffassung von der (moralisch geforderten) Kongruenz von Wissen, Verantwortung und Tun.
Die Kongruenzforderung gilt auch für Nieten, Alpha-Tiere, Narzissten, Psychopathen und Krankheitserreger in Chefpositionen. Denn: Sie haben – so der Tenor – qua Position und Funktion die Aufgabe, Mitarbeitende so zu führen, dass diese nicht Burnout-gefährdet sind. Also: Verantwortung verpflichtet. Wissen verpflichtet. Position verpflichtet. Rolle verpflichtet. Deshalb müssen Führungskräfte a) sich (Psycho-)Wissen aneignen, b) das, was sie wissen, in ihrer Rolle realisieren. Dass sie dies grundsätzlich zu tun bereit sind selbst dort, wo sie sich fachlich nicht firm fühlen, ist einem psychologisch (!) erklärbaren Bedürfnis geschuldet: dem, nicht immerzu abgewatscht zu werden.
Gerade die Führungsfunktion „Mitarbeiterführung“ ist psychologisch-pädagogisch aufgeladen. Führungskräfte kennen die Forderung, sie müssten sich als Coach und Mentor didaktisch geschickt, als Leader und Kulturmanager psychologisch einfühlsam dafür einsetzen, dass Mitarbeitende gerne und gut arbeiten und dabei gesund bleiben. Führenden wird, mit anderen Worten, die volle Verantwortung übertragen für das Wohl und Wehe anderer Menschen. Zugespitzt: Selbstverantwortung (von Mitarbeitenden für sich selbst) wird fremd zugeordnet: Für mein Wohl sorgt ein anderer. Psychologie, Pädagogik und dominantes Ethos verstärken sich gegenseitig. Die Rede von „Rechten und Pflichten“ der Führungsperson offenbart das ebenso wie das opportunistische Beipflichten der Forderungen, die von Mitarbeitenden, besonders von sogenannten High Potentials und Angehörigen der „Generation Y“, an Führende gerichtet werden. (Dazu später mehr.)
Um der „ganzheitlichen“ Verpflichtung, die Führenden übergestülpt wird, nachzukommen, benötigen sie Kompetenzen, die mit ihren fachlichen Fertigkeiten nichts zu tun haben. Es handelt sich um jene mit Namen wie: soziale, emotionale, intuitive, empathische Kompetenz (wahlweise auch: „Intelligenz“), die sich in der Art zeigen, wie sie (sich selbst und andere) führen, Gespräche gestalten, sich den Mitarbeitenden widmen?. Selbstredend benötigen sie auch Wissen, vorzugsweise bezüglich psychologischer Modelle, neurowissenschaftlicher Erkenntnisse, sozialwissenschaftlicher Befunde zur gesellschaftlichen Verfasstheit?33.
Im Zusammenhang mit dem Thema Burnout wird das Repertoire an Führungspflichten um weitere Anforderungen bereichert. Sie gelten der Prävention, Diagnose und Therapie und zentrieren explizit „den ganzen Menschen“. Die Spannbreite an Verpflichtungen ist kaum weiter dehnbar, ebenso wenig die Vielfalt überbietbar.
Das Spektrum an Führungspflichten umfasst zum einen das Ansinnen, jeden einzelnen Mitarbeitenden individuell zu betreuen, um seine „Stärken und Schwächen“, seine Neigungen und Abneigungen, seine „Ressourcen“, „Talente“ und sein „Potenzial“ zu erfassen, um ihn gezielt und „stärkenorientiert“ einzusetzen, Förder- und Weiterbildungsmaßnahmen, attraktive Karrierewege und andere „wertschätzende“ Möglichkeiten zur „persönlichen Entwicklung“ anzubieten – und damit zu garantieren, dass er „motiviert“ ist und „Spaß“ an der Arbeit hat. Das zielt – generös gedeutet – vorwiegend auf den sachlich-fachlichen Anteil der Führungsbetreuung.
Mein Der andere Anteil gilt dem physisch-psycho-sozialen Befinden. Führende sollen jeden Mitarbeitenden in seiner emotionalen Empfindlichkeit, seiner seelischen Ausgeglichenheit, seinen motorischen Bedürfnissen, seinem Bedarf nach Wir-Gefühl, Zugehörigkeit und Work-Life-Balance „da abholen, wo er sich befindet“. Dies alles sollen Führende „Empfänger-orientiert“ kommunizieren, das heißt, den vom Mitarbeiter bevorzugten kommunikativen „Sinneskanal“ berücksichtigen und die „Botschaften“ entsprechend verpacken. Und zum dritten sollen Führende dafür sorgen, dass das Unternehmen infrastrukturell Optionen bereitstellt, um Kinderversorgung und Partner-Job-Vermittlung, individuellen Bewegungsbedürfnissen und Massagebedarf, Ruheinseln und Erholungsräume, Kaffee-Ecken und News Tables (als soziale Treffpunkte) und dergleichen mehr zu garantieren. Sind Führende dafür da, den Mitarbeiter glücklich zu machen, während dieser es sich, Selbstverantwortung delegierend, in einer konsumistischen Haltung gemütlich machen kann??

Dr. Regina Mahlmann, promovierte Soziologin und Philosophin, arbeitet als Coach, Beraterin und Referentin in und für Unternehmen – als Sparringpartnerin für das Topmanagement und als Impulsgeberin und Begleiterin von Gruppen, insbesondere in veränderungsreichen und daher spannungsreichen Phasen eines Unternehmens.

