Der Deutsche beschäftigt sich gerne mit Psychokram. Gerade Frauen sind anfällig für diese Thematik. Vom Magazin bis zu den abendfüllenden TV-Formaten – die Medien greifen das Thema gierig auf. Jeder kann mitreden und „mitjammern“. Gerade letzteres könen wir exzellent.
Das Jammern ist des Deutschen Lust. Wenn die Deutschen etwas gelernt haben, nachdem sie sich ihren Wohlstand erarbeitet haben, dann ist es zu jammern, sobald er nur durch eine dunkle Wolke am Horizont bedroht werden könnte. Die bösen Asiaten nehmen uns die Arbeitsplätze, die faulen Südeuropäer nehmen uns die sichere Währung, die schmarotzenden Afrikaner verplempern unsere Fördergelder, die verschlagenen Osteuropäer kommen in unser Land und arbeiten für viel weniger Lohn als wir. Wir jammern über den Benzinpreis, die EU, den Nachbarn und die drohende Zukunft.
Kann es sein, dass tief in uns noch eine vererbte Schuld verborgen ist, die wir nicht verarbeitet haben? Das Leid, das Deutsche unter der Diktatur der Nazis über Deutschland, Europa und die Welt gebracht hat, ist unvergleichlich. Nach dem Krieg wollte von dieser Zeit und den Taten niemand mehr etwas wissen. Man hat nach vorne geguckt. Das Jammern kompensiert die Schuld etwas, nach dem Motto: „Sieh, mir geht es auch nicht gut!“ Andererseits gab es vielleicht auch genügend Täter, die es nicht verwunden konnten, zwei Weltkriege und eine Idee, die tausend Jahre reichen sollte, verloren zu haben und so im Jammern über die ganze ungerechte Welt verharrten. Wie auch immer, es ist immer schlecht, etwas Unverarbeitetes in uns gären zu lassen. Besser ist, solche Themen zu klären, bei aller negativer Erkenntnis für sich selbst. Das ist bei vielen Einzelnen unterblieben. Sicher, wir dürfen nie vergessen, was Deutsche damals gemacht haben. Wir dürfen keinen Schlussstrich ziehen. Das Thema wird dennoch unaufhaltsam mit der Zeit von Generation zu Generation abstrakter und blasser.
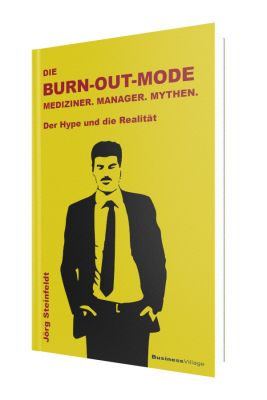
Kann es sein, dass wir einfach sehr verwöhnt sind? Nach dem Krieg ging es immer bergauf. In unseren Genen schien sich gerade einzupflanzen, es würde immer so weitergehen. Da kam die Ölkrise Mitte der 1970er-Jahre. Terrorismus, Umweltverschmutzung, staatliche Überschuldungen, Vergreisung der Gesellschaft, Finanzkrise – die Probleme wurden nicht weniger. Weder unser eigenes Leben noch Deutschland oder gar die gesamte Welt nimmt eine geradlinige Entwicklung hin zum immer Besseren. Es gibt Nackenschläge, Rückschläge, Krisen, Konflikte. Die wird es immer geben. Wir müssen lernen, das zu akzeptieren und damit umzugehen.
Kann es sein, dass uns manchmal die unbeschwerte Leichtigkeit des Seins fehlt? Unsere Großeltern und Eltern haben eines der stabilsten und reichsten Gemeinwesen der Welt geschaffen, um das uns so manch andere beneiden. Wir haben ein tolles Gesundheitswesen, dass heute sogar von vielen Ausländern, ob aus Arabien oder Osteuropa, genutzt wird. Ja, den meisten von uns geht es gut. Nehmen wir die Situation doch an und freuen uns über unsere Leistungen und unseres Lebens. Wir haben sogar die Zeit, es zu genießen, denn anders als Amerikaner und Japaner haben wir nicht nur zwei, sondern regelmäßig fünf oder sechs Wochen Urlaub. Wir sollten sogar die Großzügigkeit haben, andere von unserem Kuchen teilzuhaben, sei es im eigenen Land, Stichwort soziale Gerechtigkeit, sei es im Ausland, Stichwort sogenannte Entwicklungshilfe.
Da fehlt uns offensichtlich ein Stück der amerikanischen Mentalität, die durch und durch vom positiven Denken und Stolz auf die eigenen Leistungen geprägt ist. Oder von der Einstellung der Südeuropäer, die nicht gleich beim kleinsten Anlass in Panik geraten, sondern die Dinge zunächst so nehmen können, wie sie sind (die Finanzkrise ist da sicherlich eine berechtigte, weil extreme Ausnahmesituation). Das Schöne an den Desastern wie Stuttgart 21, Flughafen Berlin-Brandenburg, Umsetzung der Energiewende (Schaffung der Infrastruktur) oder Elbphilharmonie Hamburg ist doch zu lernen, selbst wir Deutschen sind in unseren Paradedisziplinen Planung, Organisation und Ausführung nicht perfekt. Wie menschlich, wie normal. Mit einem Augenzwinkern stelle ich fest: Ein Hauch von Südeuropa weht durch die Republik.
Vielleicht sollten wir auch nur von den Australiern lernen, dass ganz einfach Freundlichkeit das Leben angenehmer macht. Die freuen sich offenbar immer noch wie Teufel, wenn jemand sie auf ihrem etwas abseits gelegenen Kontinent besuchen kommt, obwohl die Reise im Vergleich zu vor hundert Jahren deutlich weniger beschwerlich ist. Im Sommermärchen 2006 ist uns das ganz gut gelungen, doch leider konnten wir das gute Wetter und die gute Laune nicht konstant halten.
Kann es sein, dass das Jammern gut zu einer gewissen passiven Grundhaltung passt? Ob Steinbrück seine Genossen in der SPD Heulsusen nennt oder ein Ausbilder der Hamburger Polizei von Polizeibeamten weniger Mimoserei fordert, immer ist das Gejammer der Kritisierten groß. Wer jammert, handelt nicht. Wer darüber, wie er behandelt wird, jammert, sieht sich als Opfer. Opfer sehen die Welt negativ. Damit haben sie einen „berechtigten“ Grund zum Jammern. Das ist eine perfekte sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wer als Kritisierter jammert, möchte keine Veränderung, bleibt in seiner Gewohnheit, seiner Rolle und seiner Bequemlichkeit haften. Er sieht nicht in den Spiegel und fragt „Was ist dran?“ Es gäbe wohl Antworten, die man nicht hören möchte.
Das Jammern kommt nicht von Menschen, die nackt auf dem kalten Boden sitzen. Viele Menschen haben sich ihre Komfortzonen geschaffen, aus denen heraus sie sich beklagen. In ihrem Komfort liegen sie warm und bequem und so soll es bleiben. Sie verbitten sich jede Störung.
Die Deutschen sind in Watte gepackt
Das geht im Kindergarten los. Keine Mutter, die der Erzieherin nicht antwortet: „Mein Kind tut so etwas nicht!“ In der Schule hören die Lehrer von den Eltern Forderungen, Forderungen, Forderungen. Es gibt Mütter, die haben eine Standleitung in das Lehrerzimmer. An schlechten Zensuren sind immer andere Schuld – der Stoff, die Lehrmethode, der Lehrer oder alles zusammen. Die Grundschule empfiehlt das Gymnasium nicht? Egal, die Mutter weiß es besser. Eine Versetzung ist gefährdet? Schwupp, schnell die Schule gewechselt. Doch die leiseste Anmerkung des Klassenlehrers zum lieben Kleinen löst Empörung aus, die kleinste Bitte um Veränderungen seines Verhaltens wird als Anmaßung in die inneren Angelegenheiten der Familie zurückgewiesen.
Sind Kinder früher nebenbei groß geworden, ist Erziehung heute ein Fulltime-Job. Die Ansprüche sind nicht geringer, als für die lieben Kleinen alles richtig zu machen. Wir hatten Nachbarn, deren Grundstück unmittelbar an eine Grundschule grenzt, auf die auch unsere Kinder gingen. Die Nachbarn aber ließen ihre Kinder jeden morgen zu einer anderen Grundschule karren, weil die einen besseren Ruf hatte (natürlich mit der Folge, dass ihre Kinder in unserer Straße isoliert waren, weil die Kinder sich nicht aus der Schule kannten).
Die Wirtschaft bepflastert das Wattenest. Nur ein Beispiel: Als ich schwimmen lernen wollte, musste ich auf Föhr vom Anleger springen und eine viertel beziehungsweise halbe Stunde um den Anleger herum schwimmen. Dann hatte ich meinen Frei- und Fahrtenschwimmer. Mehr Abzeichen gab es nicht. Heute werden die lieben Kleinen in Schwimmschulen in mehreren Kursen an das Schwimmen behutsam herangeführt. Neben den offiziellen Abzeichen Seepferdchen, Bronze, Silber und Gold gibt es „zur Motivation zwischendurch” Bobby Seehund, Frosch, Pinguin, Seeräuber und Seehund Trixi, um nur einige zu nennen. Die Tätigkeit Schwimmen hat sich für Menschen über Hunderte von Jahren nicht verändert. Nur die Herangehensweise ist plötzlich eine ganz andere. Rabenmutter, wer heute sein Kind vom Anleger stößt.
Arbeitswatte: Bloß keine Konflikte
Im Arbeitsleben sind die Umgangsformen so zivilisiert geworden, dass direkte Kritik weder erlaubt noch ausgehalten wird. Ein gutes Beispiel sind die Arbeitszeugnisse. Sie sollen dem Gesetz nach sowohl wahr als auch wohlwollend sein. Diese Vorgaben dienen dem Arbeitnehmerschutz. Gut gemeint. Die Realität heute ist, dass in den Arbeitszeugnissen keine negativen Aussagen mehr zu finden sind. „Das Arbeitszeugnis ist entwertet“, stellt Jürgen Hesse, seit über zwanzig Jahren Bewerbungs- und Karrierecoach, fest. Das geht bis hin zur weit verbreiteten Unsitte, dass Arbeitnehmer sich ihre Zeugnisse selbst schreiben.
Stattdessen haben sich eine – mehr oder weniger geheime – Geheimsprache und Umgehungen wie Anrufe bei den ehemaligen Arbeitgebern eines Bewerbers breitgemacht. Fernmündlich „unter vier Augen“ kann eben doch auf das eine oder andere hingewiesen werden, das merkt ja keiner. Viel schlimmer als diese unnötigen Umstände sind die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer. Keiner muss mehr Kritik fürchten, keiner hört mehr Kritik und die, die es nötig hätten, benehmen sich auch nicht mehr so, als wenn sie Folgen zu fürchten hätten.
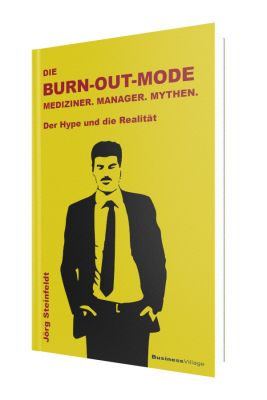
Dieses Verständnis von Zeugnissen hat sich auf die rein betriebsinternen Beurteilungen ausgeweitet. Auch da wird Kritik vermieden, fehlen Hinweise auf echte Defizite. Es wird um Silben gekämpft, zur Not Seite an Seite mit dem Betriebsrat, nur um sich anschließend wieder hinlegen zu können.
Vorgesetzte geben ihren Mitarbeitern daher oft kein echtes Feedback. Es gibt keine tiefer gehende Auseinandersetzung mit dem Mitarbeiter. Stattdessen dominiert Angst vor Auseinandersetzungen, Angst vor dem Betriebsrat, Angst davor, als schwierig zu gelten. Solche Befürchtungen sind berechtigt, denn wer wirklich führend agiert, der macht schnell keine Karriere mehr. Solches Verhalten bedeutet für Betriebsrat und Unternehmensleitung nur Ärger und Mehrarbeit und ist folglich unerwünscht.
Privatwatte: Wir bauen uns einen Kokon
Ein optimaler Nährboden für Watte ist eine gute materielle Grundlage. Normal angestellte Singles mit der in Hamburg üblichen 50-m²-Zweizimmerwohnung haben eine Putzfrau. Das mag chic sein. Das Argument ist „Ich schaffe das nicht mehr!” Sie selbst glauben das, objektiv ist es natürlich schlicht nicht wahr. Ich habe zehn Jahre alleine gewohnt, bei mäßigem Anspruch an Sauberkeit und Ordnung ging es immer ohne Putzfrau. Meine Mutter hätte nicht einmal an eine Putzfrau gedacht. Es war ihr Selbstverständnis, ihren Vierpersonenhaushalt plus Hund und trotz Halbtagsarbeit zu bewältigen. Auch meine Frau kommt bei fünf Personen, einem großen Haus und Halbtagsarbeit ohne Putzfrau aus, und das nicht, weil ich gegen eine Putzfrau wäre.
Das Essen kommt, wenn überhaupt, auch für die Kinder fertig aus der Tiefkühltruhe. Liebe geht nicht mehr durch den Magen. „Bei Ihnen wird noch richtig gekocht”, stellte die ältere Kassiererin bei Penny letztens trocken gegenüber meiner Frau fest, die diverse frische Lebensmittel auf das Band gelegt hatte. Kochen ist verkommen zum Event mit Freunden und gemietetem Koch. Der Rest lässt kochen – beim Bier aus der Flasche in der Glotze.
Den Tannenbaum lässt man fertig geschmückt anliefern und aufstellen. Kinder lernen, alles lässt sich kaufen. Selber machen hat keinen Wert mehr, selbst es für die Liebsten in der Familie zu tun, ist keine Herzensangelegenheit mehr. Jeder möchte so sein wie die Reichen, ist es aber nicht. Man lebt nicht mehr selbst, sondern lässt leben. Was bleibt ist eine Leere. Wen wundert es, dass die auf Dauer krank macht.
Diese Leere dürfte sich dann noch verstärken, wenn dieses „leben lassen“ sich nur noch auf das eigene Heim beschränkt. Unter dem Begriff Cocooning, erstmals von der US-amerikanischen Trendforscherin Faith Popcorn in den Achtzigerjahren verwendet, wird eine Tendenz bezeichnet, sich vermehrt aus der Gesellschaft und Öffentlichkeit in das häusliche Privatleben zurückzuziehen. Der Trend verstärkt sich vor allem in Krisenzeiten wie nach den Terroranschlägen vom 11. September 2011 oder in der Finanz- und Eurokrise. 37
Die Welt ist schlecht, in meinem Heim lasse ich es mir gut gehen. Neue Anreize von draußen, sich einmischen, Verantwortung übernehmen? Fehlanzeige. Hier geht es nur noch um die Gestaltung der Rabatte an der Terrasse und des Dekobords neben dem Fernseher. Die Wirtschaft hat diesen Trend längst für sich erkannt. Küchen als Wohnräume, Wellness-Bäder, Magazine wie „Landlust“, Bastelsendungen im Fernsehen und die Schnickschnack-Abteilungen von „Das Dänische Bettenlager“ bis „Bauhaus“ bedienen den Markt.
So radikal der Rückzug bei den einen, so extrem die Ablenkung bei anderen. Die leben im Zeitalter des nächsten Kicks. Barfuß durch Kambodscha, Bungee-Jumping und Kiten, Ecstasy und Speeddating. Es sind nicht selten die größten Langweiler, die sich damit interessant machen wollen, oder die mit den Komplexen, die sich nicht trauen, in den Spiegel zu sehen.
Entscheidungen für mich trifft wer?
Watte hält warm, Wärme macht träge. Die Konfrontation mit sich selbst gehört zu den schwersten Schritten im Leben eines Menschen. Dafür verlässt niemand sein Wattenest. Das „Bildung und Wohlstand für alle“ der Siebzigerjahre hat zu Saturiertheit und Lethargie geführt. Ob das gewollt war? Jetzt aber droht sich die Mittelschicht aufzulösen, es gibt keine Mitte mehr, nur noch billig oder teuer, arm oder reich. Nein, das war nicht abgemacht. Einmal Wattenest, immer Wattenest.
Trotz realer Abstiegsgefahr, die Ansprüche werden immer größer. Galten in den Sechzigerjahren die Jetsetter wie Gunther Sachs und Brigitte Bardot noch unerreichbar, glaubt heute jede Auszubildende mit Gucci Sonnenbrille und gebrauchtem Cabrio dazuzugehören. Der trommelfeuernden Werbung, den beerbten Großeltern und den Billigfluglinien sei Dank.
Die vielen Ratgeber zum Burn-out wollen immer helfen, aus dem Burn-out rauszukommen. Warum sind viele Menschen offensichtlich nicht mehr in der Lage, sich selbst nüchtern zu betrachten, für sich angemessene Entscheidungen zu treffen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und zu akzeptieren? Dann kämen sie gar nicht erst in so etwas wie Burn-out rein!
Wer im Leben Nachteile sieht, ist nie Täter, immer Opfer. Menschen ziehen weit rauf aufs Land, weil es da billiger ist, nur um den vielen Verkehr und die langen Fahrtzeiten zur Arbeit zu beklagen. Sie ziehen an Bahngleise oder Autobahnen und klagen gegen den Stress verursachenden Lärm. Mütter setzen Kinder in die Welt und wollen arbeiten, was legitim ist, wollen aber keine Betreuungskosten haben, obwohl der Mann Abteilungsleiter ist, der Q7 vor der Tür steht, das alte Siedlungshaus mit allem Angesagtem zur „Villa“ aufgemotzt wird und jedes der Kinder mit elf Jahren ein iPhone sein Eigen nennt. Eltern trennen sich und beklagen die daraus resultierenden Komplikationen und finanziellen Belastungen.
Jeder kann das alles machen, aber bitte ohne mir zu suggerieren, sie wären bedauernswerte Opfer. Wer trifft all diese Entscheidungen? Nicht ich oder irgendwer oder keiner, sondern nur derjenige, der diese Dinge selbst tut. Jeder trägt für sein Tun und Unterlassen selbst die Verantwortung. Dem gerecht zu werden, erfordert bei vielen eine neue Einsicht, die der Selbstverantwortung.
Schlecht dran sind die, die zum Leben nicht die Reife entwickelt haben, für sich Gut von Schlecht unterscheiden und danach handeln und entscheiden zu können. Wer sich von zu vielen (globalen) Informationen erschlagen fühlt, hat schlicht das (Bildungs-)Defizit, nicht zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden zu können, und nicht genug Charakter für den Mut zur Lücke. „Gerade Menschen mit Selbstwertproblemen sind durch die ständige Erreichbarkeit leicht verführbar. Sie schaffen sich die Illusion von Sicherheit und Stärke durch das Gefühl: Ich werde gebraucht, ich bin unersetzlich“, sagt Götz Mundle, Chefarzt der Oberbergkliniken. 38 Das sind individuelle Defizite. Dafür kann die Gesellschaft nichts, höchstens „Schönen Gruß an die Eltern!”
So steht es jedem frei zu entscheiden, wo und wie er arbeitet, auf was er sich einlassen möchte. Wer dabei seine eigenen Fähigkeiten über- und die Anforderungen an ihn unterschätzt, trifft schlicht eine Fehlentscheidung.
Die Sozialdemokratisierung der Gesellschaft ist falsch verstanden worden. Gleiche Chancen für alle bedeutet nicht, die Leistungshürden soweit runter zu hängen, dass jeder rüberkommt. Auch nicht, dass wenn ich eine Hürde nicht packe, diejenigen Schuld haben, welche die allgemeingültigen Hürden aufgestellt haben. Es ist für den Einzelnen schön, wenn auch er das Abitur hat und auch er Karriere macht, mittelfristig verlieren aber alle, wenn das allgemeingültige Niveau ins Bodenlose sinkt. Das mag bei den Ergebnissen der PISA-Studien noch nicht wirklich wehtun. Wenn die Bildungsdefizite aber im richtigen Leben, zum Beispiel am Arbeitsplatz, offensichtlich werden, dann wird es ernst. Dann ist die Wissensgesellschaft Deutschland im Wettbewerbsnachteil. Dürfen wir den vielen Mittelständlern glauben, die schon heute bei Schulabgängern Bildungsdefizite ausmachen, dann haben wir akuten Handlungsbedarf.
Psychowatte: Danke Burn-out!
Burn-out ist das Produkt, das jedem die begehrte Watte für seine Probleme liefert. Unter dieser Überschrift hat jeder die Möglichkeit, sich aus der Normalität auszuklinken.
In den Siebzigerjahren tauchte der Begriff „Stress” auf. Wer Stress hatte, hatte viel zu tun. Das war sein Pech, aber auch sein Glück. Denn Stress zu haben bedeutete auch, als Herkules zu gelten, dem entsprechend viel und noch viel mehr zugemutet wurde. Stress war diffus und jeder musste selber sehen, wie er damit klarkam.
Seit der Jahrtausendwende etablierte sich das Mobbing. Wer gemobbt wurde, war kein Aufopferer, sondern nur Opfer. Wer sich als Mobbingopfer erklärte, war als Verlierer gebrandmarkt. Immerhin hatte es der Begriff geschafft, die Schuld und damit die Verantwortung der eigenen misslichen Lage allein anderen zu geben.
Burn-out verbindet Stress und Mobbing auf eine ideale Weise. Viel zu tun zu haben, also eigentlich ein Held zu sein, und die Verantwortung für das eigene Scheitern bei anderen abzuladen. Verbal angeklagte Arbeitgeber sind sofort in der Verteidigungshaltung. In den USA aus Angst vor juristischen Klagen, in Deutschland, weil wir einen offenen und objektiven Umgang mit denen scheuen, die sich ein Wattenest gebaut haben.
Auch hier ist die Sozialdemokratisierung unserer Gesellschaft falsch verstanden worden, und zwar von Politikern, die sich zwar über mangelnden Zuspruch von Wählern wundern, aber die die Überzeugungen ihrer eigenen Klientel nicht verstehen können oder wollen. Auch und gerade sozialdemokratisch orientierte Arbeiter und Angestellte, die ihr Leben lang gearbeitet haben, haben für Wattenester auf ihre Kosten kein Verständnis.
Immer wieder wird als ein positiver Aspekt der Burn-out-Mode die gewachsene Sensibilität für psychische Belastungen am Arbeitsplatz genannt. Weshalb am Arbeitsplatz? Die Psyche eines Menschen betrifft ihn in seinem ganzen Leben. Sie wird nicht nur vom Arbeitsplatz beeinflusst, sondern, vor allem in jüngeren, prägenden Jahren vom Elternhaus, Kindergarten, Schule und sozialem Umfeld.
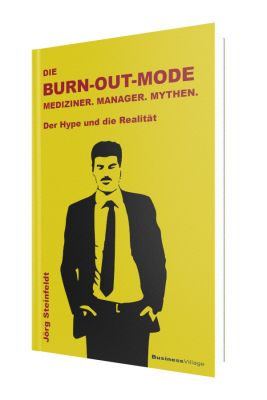
Die Deutschen sollten sich insgesamt mehr mit ihrer Psyche befassen. Aber Psyche ist für die meisten Deutschen Hokuspokus. Sigmund Freud und Psychoanalyse? Ein Spinner und Quatsch! Aufarbeitung der Verbrechen durch und im Namen der Deutschen? Besser nicht! Psychiater? In die Klapsmühle gehören andere. Die Deutschen tun sich schwer mit Befreiungen, ob aus wirtschaftlichen Zwängen vor gut hundert Jahren, politisch vor knapp siebzig Jahren, kulturell und sexuell vor rund vierzig Jahren oder ihr Leben lang mit der Befreiung von Blockaden im eigenen Kopf. Selbst viele Vorgesetzte sehen in einem Coaching nur verschwendete Zeit.
Doch Burn-out reißt die Blockade zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich nicht ein. Die einen kommen gar nicht auf die Idee, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sind sie doch nur Opfer ihres Umfeldes. Die anderen werten Burn-out nicht als psychische Angelegenheit, gar als Krankheit. Es ist eine schicke Mode, ein Accessoire des Lebens. So, wie in bestimmten Kreisen das eigene Pferd, das Koksen oder der Weihnachtseinkauf in London dazugehört. „Der Erschöpfungsgrad ist beinahe schon so etwas wie ein eigenes Leistungsmerkmal. Es gibt einen regelrechten Erschöpfungswettbewerb. Je erschöpfter wir sind, desto mehr haben wir geleistet“, stellt Ines Imdahl, Psychologin, fest. 39 Jeder, der etwas auf sich hält, sollte sein Burn-out haben. Zukünftig werden wir in heldenhaften Lebensgeschichten, die wir hören oder lesen, immer ein Kapitel „Und dann hatte ich mein Burn-out” finden. Opfer ist, wer da nicht mithalten kann.

Der Jurist Jörg Steinfeldt, Jahrgang 1962, war über 25 Jahre Führungskraft bei einem internationalen Spezialversicherer, unter anderem im Personalbereich. Er ist Buchautor und Autor zahlreicher Fachartikel. Steinfeldt ist bekannt dafür, den Finger in offene Wunden zu legen und über den Tellerrand zu denken. Schon in seinem Debüt-Buch „Was Sie schon immer über Führung wissen wollten“ räumt er schonungslos mit den Management-Mythen auf. Er ist in Hamburg geboren, wo er mit seiner Frau wohnt, während seine drei Kinder in die Welt hinausziehen.

