Wer aufgibt und sich von einem Ziel verabschiedet, gilt als Versager. Genau aus diesem Grund halten viele Menschen an unrealistischen Zielen fest und verfolgen sie trotz Aussichtslosigkeit. Weitermachen ist leichter als Aufgeben – denn zum Aufgeben braucht man oft mehr Mumm als zum Weitermachen.
Jeder, der beabsichtigt aufzugeben, ist begleitet von negativen Gefühlen wie Scham oder Angst, als Versager dazustehen. Deshalb gibt es so viele Menschen, die an unerreichbaren oder unrealistischen Zielen festhalten.
Denen darf man getrost eine uralte Weisheit der Dakota-Indianer mit auf den Weg geben, die besagt:
»Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab.«
Dass das Aufgeben für so viele Menschen eine schwierige Option zu sein scheint, liegt an zwei wesentlichen psychischen Prozessen, die bei der Zielverfolgung ausgelöst werden. Zum einen werden Steuermechanismen in Gang gesetzt, die einen sehr großen Teil unserer Gedankeninhalte in den Dienst der Umsetzung und Realisierung stellen. Dazu gehört es auch, entmutigende Fakten und objektive Handlungsbarrieren zur Aufrechterhaltung der Zielkonsequenz auszublenden. Unser Gehirn arbeitet hier sehr sorgfältig, und wir nehmen sie einfach nicht wahr oder erinnern uns nicht mehr an sie. Und wenn sie doch mal wahrgenommen werden, dann werden sie häufig unterschätzt. Der zweite Mechanismus, der uns weiter an einem gefassten Zielvorhaben festhalten lässt, ist die menschliche Neigung, an einem selbst ungünstig verlaufenden Projekt oder Vorhaben festzuhalten, wenn wir schon viel Zeit, Energie oder sogar Geld investiert haben. Schleicht sich nämlich der Gedanke ein, das angestrebte Ziel könnte doch kein realistisches mehr sein, denken viele Menschen über die bisherigen Bemühungen nach, die bei einem Aufgeben alle verloren wären. Das verleitet unzählige Menschen dazu, doch weiterzumachen, denn Kosten und Verlust will jeder gerne vermeiden. In diesem Fall gilt es, sich von dieser Kostenverlust-Geschichte gedanklich zu verabschieden und sich wesentlichen Fragen zu widmen wie etwa: Ist mir persönlich das angestrebte Ziel wirklich noch wichtig?
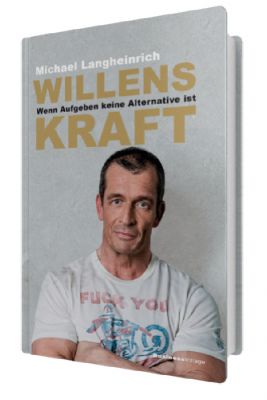
Haben sich Fakten, Handlungsbarrieren oder Umstände ergeben, sodass das Erreichen meines Ziels unrealistisch geworden ist, ganz gleich, wie viel Mühe ich mir auch geben werde? Habe ich in der jüngeren Vergangenheit die Fortschritte gemacht, die ich geplant und gewünscht habe? Habe ich schon Schwierigkeiten gemeistert und bewiesen, dass ich Hürden und kritische Phasen überwinden kann? Eine mehrtägige oder bei einem langfristigen Ziel sogar eine mehrwöchige Selbstbeobachtungsphase hilft Ihnen herauszufinden, ob der Zeitpunkt zum Aufgeben gekommen ist. In diesem Zeitraum gilt es, drei Dingen Aufmerksamkeit zu schenken: dem körperlichen Wohlbefinden, der emotionalen Stimmung und der objektiven Analyse der Situation gemäß den vorher genannten Fragen. Das körperliche Wohlbefinden wird von Stress beeinflusst, wenn Sie sich beispielsweise das Ziel zu hoch gesteckt haben. Typische Symptome können dann Schlaflosigkeit, Antriebslosigkeit oder auch innere Unruhe sein. Neben den körperlichen Auswirkungen gilt es, die oft seelischen Ursachen zu beachten. Der Neurowissenschaftler Antonio Demasio hat in seinen Forschungen gezeigt, wie wichtig Gefühle, Empfindungen und Emotionen bei all unseren Entscheidungen sind. Also stellen Sie sich selbst auch mal ein paar Fragen in diese Richtung wie beispielsweise: Bin ich zufrieden? Wie fühle ich mich? Empfinde ich Machtverlust gegenüber Situationen? Schon ein kleines Gefühl des Kontrollverlustes gegenüber Situationen können ein Zeichen dafür sein, dass Ihnen die Einhaltung der Zielkonsequenz zu viel abverlangt.
Sobald Sie hier klare Antworten gefunden haben, entscheiden Sie neu aufgrund neuer Gegebenheiten und Tatsachen.
Fazit
Wenn Sie sich entschlossen haben, die Reißleine zu ziehen, und aufgeben müssen, sollten Sie am besten nicht alles auf einmal stehen und liegen lassen, sondern wenn möglich in kleinen Schritten aufhören.

