Ein Vermögen wie Warren Buffett aufbauen? Vom Tellerwäscher zum Millionär? Das sollte doch locker drin sein. Kasten und Berufsstände gehören ja der Vergangenheit an, Lebenswege sind nicht vorgezeichnet und Schicksale nicht mehr unausweichlich. Leistung bringt Erfolg: »Jeder kann es schaffen.« Das ist das Versprechen. Doch dieses Versprechen ist leer.
Wir alle leben heutzutage in einer Zeit der großen Versprechen: Jeder kann es schaffen, heißt es. Auf den ersten Blick scheint es sogar so zu sein. Warum sonst sollten wir uns so für diese Dinge ins Zeug legen? Es gibt jedoch noch eine andere, überzeugendere Erklärung: Wir wollen diese Dinge nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen anderer Dinge, zu denen sie uns verhelfen – Anerkennung, Respekt, Bewunderung, Status. Ein Titel ist nur dann toll, wenn die anderen ihn toll finden. Eine bestimmte Automarke fährt nicht unbedingt besser als eine andere, günstigere Automarke, ist aber repräsentativer. Diese Autos, diese Titel und diese Visitenkarten sind nur kleine Figuren in einem Spiel, in dem es um Erfolg geht. Das wäre an sich nicht weiter schlimm – wenn dieses Spiel funktionieren würde. Doch wir leben in einer Zeit, in der dieses Spiel nicht mehr funktioniert. Aber die Menschen wollen immer noch gerne an diese Chancengleichheit glauben. Daraus entstehen jene Hoffnungen und Erwartungen und jene krisenhaften Momente der Selbstunzufriedenheit, mit denen wir es heute zu tun haben.
In der Abteilung »Selbstoptimierung« gut sortierter Buchhandlungen und Onlineshops findet man zwei Kategorien von Büchern, die Erfolg versprechen. Die erste Kategorie verspricht den Leserinnen und Lesern, jeder könne es schaffen, man müsse nur fest an sich glauben. Die zweite Kategorie will den Leserinnen und Lesern dabei helfen, mit Misserfolgen klarzukommen.
Es wird behauptet, Erfolg sei ganz einfach. Norman Vincent Peale schrieb in seinem Buch Die Kraft positiven Denkens, dass der entscheidende Faktor des Erfolgs der erfüllbare Wunsch sei.
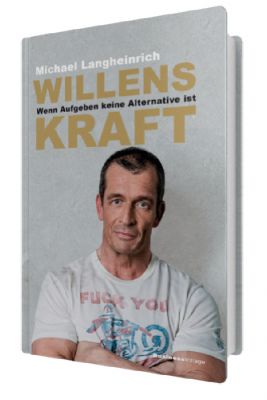
Wer davon ausgeht, dass er erfolgreich sein wird, der ist bereits erfolgreich. Dieses Buch verkaufte sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts massenhaft und lässt sich mit den einfachen Worten zusammenfassen: »Man muss nur an sich glauben.« In seinem Bestseller Denke nach und werde reich schrieb der US-amerikanische Schriftsteller Napoleon Hill, dass man sich nur überlegen solle, wie viel Geld man besitzen möchte. Er forderte seine Leserinnen und Lesern auf, diese Summe auf ein Blatt Papier zu schreiben – und dann daran zu glauben, dass sich diese Summe schon in ihrem Besitz befände. Solche Aussagen verführen Menschen dazu, sich völlig unrealistische Ziele zu setzen. Es entsteht der Eindruck, Reichtum, Glück, Zufriedenheit, Harmonie seien leicht zu haben, und es wird suggeriert, mit bestimmten Denkmustern, die man wie ein Mantra abruft, könne man sich selbst reich machen, andere Menschen beeinflussen und mit der Kraft der eigenen Gedanken quasi die Realität verändern. Mit anderen Worten: Ich denke mir mein leeres Bankkonto einfach weg. Wenn ich nur fest genug daran glaube – Schwupps –, ist es wieder voll. Das ist aber verdammt unrealistisch, weil ich wahrscheinlich mit dieser Vorgehensweise mein ganzes Geld bereits in wirkungslose Bücher und Kurse investiert habe.
Ebenfalls besonders kontraproduktiv sind finanzielle Anreize. 1999 wertete der US-Psychologe Edward Deci von der Universität von Rochester einhundertachtundzwanzig Studien aus, die sich mit den Folgen von Belohnungen beschäftigten. Sein Fazit: Materielle Belohnungen zerstören intrinsische Motivation.
Mehr Geld spornt nicht an – dahinter steckt folgendes Prinzip: Wenn wir etwas gerne tun, etwa weil wir es genießen oder daraus lernen, sind wir von alleine motiviert. Kommt die Belohnung ins Spiel, fokussieren wir uns unmittelbar auf sie und gehen der Tätigkeit nicht mehr aus purem Vergnügen, sondern reinem Profitstreben nach. Vereinfacht gesagt: Wir verlieren die Lust. Die Forscher und Psychologen erzählen uns immer wieder gerne, dass man Glück mit Geld nicht kaufen kann. Ich weiß, was Sie jetzt denken: Wie viel verdienen denn diese Forscher und Psychologen eigentlich?
Das, was jeder im Grunde genommen aber sucht, ganz egal ob mit viel Geld oder mit weniger Geld, ist Glück. Alles auf der Welt wird größer und mehr. Mehr Städte, Häuser und mehr Vermögen. Reiche haben mehr Geld, aber die Zahl der armen Menschen wächst, sie werden jeden Tag mehr.

Nur mit dem Glück, mit dem Glücklichsein, geht es nach unten. Wer von Ihnen erinnert sich noch an seine Kindheit, in der man Glück einfach nur als einen zum normalen Leben gehörenden Zustand empfunden hat? Erinnern Sie sich an Momente, in denen alles reine Freude war, an Momente, in denen alles in unserer Welt, in uns und um uns herum, einfach okay war? Es fühlte sich einfach alles in diesen Momenten richtig an. Jetzt aber, als Erwachsene, haben wir den Salat, wir sind erwachsen und vieles fühlt sich nur noch falsch an. Viele Menschen haben jedenfalls eine derartige Wahrnehmung von ihrem Leben. Es ist fast so, als wären sie auf Schatzsuche nach diesem verlorenen Glück. Doch je mehr wir uns darauf konzentrieren, das Glück wiederzufinden, umso mehr zieht es sich zurück.
Mir scheint es so, dass wir in den Momenten, in denen wir nicht das Glück suchen, sondern etwas ganz anderes tun, ein wenig von diesem alten Glücksgefühl der Kindheit wieder spüren können. Immer wenn wir uns Mühe geben bei einer Aufgabe, wenn wir uns anstrengen, nach Erfolg streben, dann erleben wir Glück. Das Glücksgefühl stellt sich zumindest bei mir viel eher als Nebenprodukt, als ein Geschenk am Rande ein. Ich habe für mich die Konsequenz daraus gezogen, dass ich mich nicht tagelang mit der Sinnsuche und dem Entdecken eines viel beschworenen Glücks beschäftige, sondern mein Glücksgefühl bei der Suche und beim Streben nach Erfolg, in welcher Sache auch immer, entstehen lasse. Überlegen Sie vielleicht an dieser Stelle, ob es bei Ihnen nicht auch ganz ähnlich ist.

