Die Überschrift dieses Artikels ist etwas gewagt. Aber sie verdeutlicht den bisherigen Weg: Hybrid meint hier die Verbindung von klassischen psychologischen Ansätzen, denen Führende Einträge in ihr Pflichtenheft verdanken, und zaghaften system-psychologischen Ansätzen, die den Schwerpunkt zumindest verlagern auf Prozesse, Beziehungen, Muster in Kommunikation und Interaktion. Allerdings ist evident: Auch das Hybride greift im Zweifel auf die Vorstellung der psychologisch (kognitiv, emotional) außergewöhnlich gebildeten, überlegenen Führungspersönlichkeit zurück, die unfreiwillig und ungefragt stets im Lead, also in der Verantwortung für die Qualität der Befindlichkeit von Mitarbeitenden steht.
Die bisherige Diagnose ergibt, dass Psychologisierung unter dem Vorzeichen von Rechten und Pflichten eine Schlagseite generiert: Verpflichtungen wachsen für Führende, Rechte auf Ansprüche gedeihen auf Mitarbeiterseite. Der Pflichtenaddition entspricht eine Anspruchs- oder Rechteaddition.
Das geht nicht zuletzt auf die zwei Seiten des Arbeitsvertrages zurück. Der formale Aspekt betrifft den Deal: Leistung gegen Entlohnung. Der psychologische Aspekt ist informell. Dietrich von der Oelsnitz, Professor und Leiter des Instituts für Organisation und Führung an der TU Braunschweig und geschäftsführender Herausgeber der „Zeitschrift für Management“, beschreibt den psychologischen Vertrag so: „Dieser ,regelt‘ (….) die impliziten gegenseitigen Erwartungen und Ansprüche von Organisation und Mitglied, also zum Beispiel die manchmal erforderlichen Zusatzschichten am Wochenende, die Hilfsbereitschaft gegenüber Kollegen, das Mitdenken am Arbeitsplatz, eine besondere Verschwiegenheit; kurzum: die unausgesprochenen Normen des Systems. Insofern ist Personalmanagement immer auch Erwartungsmanagement.“
Das Verlockende dieser beispielhaften Nennungen ist, dass sie bei Führenden Affirmation hervorrufen. Das tun sie, weil sie sich auf arbeits- und unternehmensrelevante Komponenten beziehen und Anforderungen formulieren, die von Mitarbeitenden zu erfüllen sind. Das ist jedoch vordergründig und nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist für Führende brisanter. Denn der psychologische Vertrag, der als „wirkmächtig“ beurteilt wird, impliziert Seelisches und Emotionales, Aspekte von Gemütsverfassung und Befindlichkeit. Wenn Mitarbeiterführung als Erwartungsmanagement beide Aspekte inkludiert, dann sind Führende genötigt, sich um alle (!) jene Erwartungen zu kümmern, die Mitarbeitende hegen (könnten) und als Ansprüche formulieren. Unter diesen Erwartungen tummeln sich auch jene, die das psychosoziale Wohlbefinden des „ganzen Menschen“ einbeziehen und mit dem Arbeitsplatz bestenfalls indirekt zu tun haben.
Mitarbeiterführung als Erwartungsmanagement zu bezeichnen, legt aus einem weiteren Grund die Schneise für Psychologisierung: Sie hat keinen eingebauten Stopp. Wie, könnte man fragen, kann eine Führungsperson „berechtigte“ von „unberechtigten“ Erwartungen unterscheiden und ihre Entscheidung begründen? Dafür gibt es keinen Kriterienkatalog. Führende müssen Grenzen selbst ziehen. Bumerangartig kriegen sie eine Grenzziehung als Vorwurf zurück, indem diese als willkürlich gebrandmarkt wird.
Beispielhafter Mitarbeiterdialog:
Mitarbeiterin: „Ich fühle mich erschöpft und befürchte, dass ich allmählich Richtung Burnout wandere. Dem will ich vorbeugen. Ich habe mich auch schon umgesehen und einen Kursus entdeckt, der mir helfen kann, mich besser zu entspannen. Es ist eine Klangschalentherapie.“
Die Vorgesetzte lässt sich die Unterlage zeigen und schüttelt den Kopf: „Tut mir leid, aber das kann ich nicht unterschreiben. Das ist zu esoterisch. Lassen Sie uns doch erst einmal schauen, was wir in der Arbeitsorganisation verändern können. Was macht Ihnen denn besonders zu schaffen?“
Die Mitarbeiterin reagiert empört und betont, dass sie „viele Leute“ in ihrem Bekanntenkreis habe, denen Klangschalen sehr geholfen hätten, „zur Ruhe zu kommen“ und „sich zu zentrieren“.
Das Gespräch dauerte knapp eine Stunde. Am Ende gab es eine wütende Mitarbeiterin: „Sie wollen mich gar nicht unterstützen! Ihnen scheint es egal zu sein, wie ich mich fühle und ob ich vor Erschöpfung zusammenbreche!“ Und es gab eine ratlose Chefin, die ihren Coach fragte: „Was muss ich eigentlich alles bewilligen, um meiner Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber nachzukommen? Was ist falsch daran, erst einmal zu überprüfen, was genau in der Arbeit besonders erschöpfend sein soll? Und worin liegt die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter für ihr eigenes Leben? Wenn der Kursus so toll sein soll, dann kann sie ihn doch machen, allerdings soll sie ihn dann selbst bezahlen. Ist das schon mitarbeiterverachtend?“
Klare Richtlinien, die angeben, unter welchen Bedingungen und nach welchen Kriterien Ansprüchen aus einem psychologisierenden Denken Einhalt geboten werden kann, sind nicht in Sicht. Zwei Gründe plausibilisieren das – und sind gleichzeitig Quelle sowohl für den Jahrmarkt psychologischer Anforderungen an Führungspersonen als auch für die Kakophonie der Vorwürfe. Wenn etwas im besagten Sinn grenzenlos ist, kann sich jeder bedienen. Psychologisches Denken, insbesondere der tiefenpsychologischen und humanistischen Tradition, eignet sich dafür besonders. Es operiert unter anderem mit Kategorien, die für ein geschlossenes System charakteristisch sind. Dazu zählen die Figur des „Unbewussten“ und die Logik von Repräsentativität. Die Formel lautet: „Sie wünschen sich eigentlich, dass … – Ihnen ist das nur nicht bewusst.“ In der Symbolik des „X steht für Y“ (Repräsentativitätslogik) ist begründet, dass etwas anders sein kann, als es scheint. Etwa: „Die ständige Furcht davor, dass Sie Ihr Kollege nicht wertschätzt, steht vermutlich für Ihre tiefere, grundsätzliche Angst vor Ablehnung.“
Ein Dauerlauf mit Siebenmeilenstiefeln durch die bisherige Diagnose verdeutlicht, dass es an eingebauten Kriterien für einen „Stopp“ der Psychologisierung auch im Pflichtenheft für Führende mangelt.
Psychophysik und -technik und auch die frühe Verhaltenspsychologie können wir wegen der naturwissenschaftlichen Codierung übergehen (Messung, Beobachtung, Konditionierung). Zwar macht das Verstärkungsmoment der späteren Verhaltenspsychologie Führung bereits aufwendig – allerdings mit einem klaren Kriterium: Beobachtbarkeit.
Das sei am Beispiel des Dauerbrenners „Motivation“ und dem noch heute verbreiteten Missverständnis, Führungskräfte müssten Mitarbeitende motivieren, illustriert: Führende setzen Anreize, um zu Leistung anzuspornen. Aber aufgepasst! Selbst wenn die Chefin weiß, was einen Mitarbeiter generell besonders motiviert, muss sie erst prüfen, ob dieser Ansporn in der aktuellen Situation attraktiv ist. Ist ein Mitarbeiter etwa als Gadget-affin bekannt, lässt er sich von der Aussicht, ein weiteres digitales Gerät zu erhalten, nur dann motivieren, wenn er nicht schon das neueste besitzt. Das kann die Chefin direkt erfragen. Außerdem muss die Chefin die mit zeitlichen Intervallen von Belohnen, Ignorieren, Bestrafen verbundenen Kenntnisse haben und individuell übersetzen. Verhaltenspsychologisch zu führen, ist keine simple Angelegenheit. Aber noch ohne Tiefenbohrungen und Hellseherei möglich.
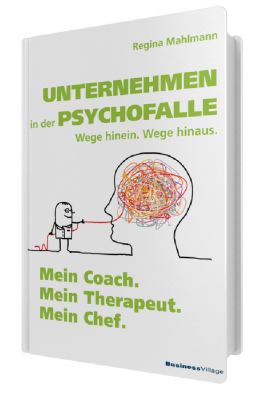
Brenzliger wird es mit der kognitiven Wende in der Verhaltenspsychologie; denn mit ihr wird das Feld der unmittelbaren Beobacht- und Beschreibbarkeit, der sinnlichen Wahrnehmung und Messbarkeit streckenweise verlassen. Führende müssen sich auf das Glatteis von Mutmaßungen begeben. Lern- und Denkvorgänge können selbst nicht beobachtet, sondern nur deutend und wertend erschlossen werden. Führende sollen – so die Forderung – im Umkreis der Idee der Umdeutung dazu anregen, Affekte und Emotionen zu reflektieren, zu überprüfen, kognitiv zu überformen und durch rationale Gedanken zu ersetzen (RET, siehe oben).
Am Beispiel Motivation:
Wenn der Mitarbeiter meint, die Chefin trüge ihm minderwertige Aufgaben an, dann soll sie ihn dazu anregen, zu untersuchen, welche Hintergrundannahmen dieses Urteil hervorbringen und welche positiveren, „motivierenden“ Deutungen möglich wären. So könnte aus der „minderwertigen“ Arbeit eine Arbeit werden, die für den laufenden Betrieb unverzichtbar und deshalb von herausragender Bedeutung ist.
Das verhaltenspsychologische Konzept „Modelllernen“ oder „Lernen am Vorbild“ verwandelt Führende in Vorbilder. Sie werden zu lebenden Modellen, an denen sich Mitarbeitende orientieren können sollen. Das Vorbild-Postulat nimmt einen bis heute prominenten Platz im Pflichtenheft für Führungskräfte ein.
Das psychologisierende Moment dieser Funktion liegt darin, dass Führende überlegen müssen,
- a) welche Verhaltensweisen nachahmenswert sind,
- b) wie ihr konkretes Verhalten von Mitarbeitenden gedeutet werden kann,
- c) wie Mitarbeitende handelnd darauf reagieren könnten,
- d) wie sie, die Führenden, sich wiederum daran ausrichten, ohne als Fähnlein im Wind, als Weichei oder schlicht als insouverän bei eben diesen Mitarbeitenden zu gelten. (Ein Schelm, der hier eine paradoxe Anforderung wittert.)
Da Führende keine Hellseher sind, verkompliziert sich Führungshandeln nicht nur, sondern wird komplex. Sie sollen jedoch mit der Blackbox „Psyche“ so umgehen, als wäre sie transparent, als wären Inhalte und Operationen einsehbar, berechenbar und „angemessenes“ Antworten möglich.
Der Ansatz des Modell- oder Vorbild-Lernens infantilisiert und vernachlässigt eine Differenzierung. Er verkindlicht Mitarbeitende und postuliert einen nicht-notwendigen Zusammenhang. Er verdammt Führende dazu, dem Diktum zu huldigen: „Alles, was du tust, musst du so tun, dass es nachahmenswert ist.“ Und: „Man kann nicht von anderen etwas fordern, das man selbst nicht macht.“ (Hier liegt ein Denkfehler vor: Rollendiffusion. Die Unterschiedlichkeit von Rollen wird ignoriert. Es wird so getan, als ginge es um „dasselbe“.) Die praktische Folge dieses fehlerhaften und zudem moralisch-pädagogisch aufgeblähten Redens: Führende versuchen, etwas „vorzuleben“, beispielsweise Motivation.
Angenommen – um das obige Beispiel aufzugreifen –, die Chefin versteht unter „Motivation vorleben“ dies: ständig mit Lächeln und begeisternden Redewendungen ermuntern, Feiern jedes noch so winzigen Erfolges als Meilenstein, heitere Umdeutungen von „schwierigen Zeiten und enormer Belastung“ in „kreative Herausforderungen, die nur mit außergewöhnlichem Einsatz und originellen Köpfen gemeistert“ werden können. Das ist gut gemeint. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Mitarbeitende das selten goutieren. Das Risiko ist hoch, dass sie urteilen: „Die Chefin hat den Blick für das Reale verloren – und überhaupt, dieses ständige Begeistert-Sein-Getue überzeugt doch nicht!“
Noch diffiziler wird Führen mit dem wachsenden Einfluss von Tiefenpsychologien. Das verdankt sich insbesondere den Konstrukten „das Unbewusste“, „Kindheit als determinierende Phase/Prägung“, der Logik der Repräsentativität (X steht für Y), „Selbstwertgefühl“, „Minderwertigkeitskomplex“. Jetzt ist die Führungskraft aufgerufen, im einfühlsamen Gespräch mit dem Mitarbeiter in dessen geschlossenen Seelen-Schubladen herumzuwühlen. Die Aufgabe besteht darin, mögliche wirkmächtige unbewusste Motive, Präferenzen, Gefühle und deren vermeintliche Herkunft aus der individuellen Biographie zu rekonstruieren und „hinter“ den „Symptomen“ aufzudecken, was „das Eigentliche“ ist. Das Ziel dieses Unterfangens lautet: „angemessen“ auf partikulare Bedürfnisse von Mitarbeitenden zu reagieren.
Wieder am Beispiel Motivation konkretisiert: Die Chefin verlangt für einen definierten Zeitraum extraordinäres Engagement. Ein Mitarbeiter scheint das zu überhören, denn er schlawenzelt in verschiedenen Abteilungen herum, zumeist mit mürrischem Gesichtsausdruck. Die Chefin muss ihn dabei ertappen, ihn zum Gespräch bitten und ihm Fragen danach stellen, wie sie sein Verhalten interpretieren soll. Die Antwort „Ach, ich sehe einfach keinen Sinn in der Hektik“ muss sie feinfühlig zum Ausgangspunkt weiteren Fragens machen. Ziel ist, dem „wirklichen“ Grund seiner empfundenen Sinnlosigkeit und Hektik auf die Spur zu kommen, um ihm dann ein „adäquates“ Angebot zu machen.
Der Humanistischen Psychologie verdanken Führende eine weitere Psychologisierungswoge. Diese Welle schwappt in Konzepten wie „Persönliches Wachstum“, „Selbstverwirklichung“, „Ganzheit“ und „Sinn“ ins Pflichtenheft von Führenden. Wie die anderen Psychologieströmungen operiert Humanistische Psychologie mit allgemeingültigen Annahmen. Besonders einschlägig, weil nachhaltig wirksam, sind diese: Jeder Mensch muss, will er nicht seelisch leiden, notwendig das eigene Leben mit Sinn füllen. Diese Lebenspflicht umfasst Selbstverwirklichung als Lebensaufgabe und damit persönliches Wachsen, Aufdecken und Entfalten von Potenzialen, Talenten, Neigungen und das Aktivieren schlummernder Ressourcen. Arbeit kommt dabei ein hoher Stellenwert zu 148. Die Folge: Individualisierung, präziser: Partikularisierung von Mitarbeiterführung bricht sich Bahn.
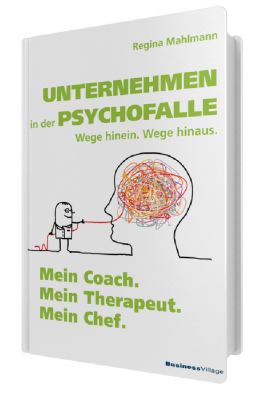
Führende tragen demzufolge dafür Sorge, dass Mitarbeitende dies alles tun können. Nicht per Delegation an die Personalabteilung, sondern in der täglichen Arbeit. Der Arbeitsalltag wird zunehmend als Betreuungsverhältnis entworfen. „Führungskraft als Coach“ heißt es ab den 1980er-Jahren, und im dritten Jahrtausend kommt der Mentor wieder zum Vorschein. Führende müssen mit Geführten in einem „ständigen Austausch“ sein, begleitet von psychologisierenden Nachfragen, ob Mitarbeitende „den Sinn in der Arbeit“ nicht nur erkennen, sondern ihn auch „annehmen“, sprich: „integrieren“ können in den eigenen Lebensentwurf; ob sie „wirklich“ das meinen, was sie sagen, und „wirklich“ das wollen, was sie formulieren, und was sie noch „benötigen“, um sich für das Unternehmen engagieren zu wollen und zu können.
Wieder am Beispiel Motivation: Der Chefin eines de- oder unmotiviert erscheinenden Mitarbeiters obliegt es, einen empathischen Dialog zu initiieren. In diesem fahndet sie nach „offenkundigen“, bewussten sowie nach latenten, unbewussten Gründen (Motiven) dafür, dass sich der Mitarbeiter in seinem Engagement zurückhält (pardon: zurückzuhalten scheint). Zusätzlich lotet sie mit ihm aus, inwiefern der Aufgabenbereich, samt seiner Kompetenz und Zuständigkeit, ihm sinnvoll erscheint, in seine Lebensplanung passt und er sich insofern „ganzheitlich“ einbezogen, berücksichtigt und behandelt fühlt. Damit die Chefin ein so geartetes psychotherapeutisches Gespräch überhaupt führen kann, empfehlen humanistische Psychologen Frageformeln aus der Gesprächspsychotherapie und systemische Psychologen Varianten systemischer Frageformen.
Systemische Psychologie verlegt zwar grundsätzlich den Fokus von der Person auf Beziehung und deren Dynamik, auf Interaktion, Korrelation und Kommunikation, auf Wirklichkeit als (individueller bzw. sozialer) Konstruktion, auf Selbstorganisation und -regulation. Jedoch drückt auch sie (vor allem in ihrem personalen Zweig) die Führungsperson fest auf den Thron. Führende bleiben, wo sie sind (auf dem Thron) und was sie sind: exponiert (Chef), Projektionsfläche (Sollens-Anforderungen) und Attributionsziel (Chefs sind verantwortlich und daher im Zweifel immer die „Schuldigen“).
Führende sollen unter konstruktivistischem Vorzeichen Beziehungsdynamiken und Muster erkennen. Sie sollen Stellhebel finden, um systematisch Störungen zu veranlassen und über diese neue Ordnungsbildung zu veranlassen. Gleichzeitig gilt: Führende werden ihrerseits durch Mitarbeitende gelenkt. Das sollen sie durchschauen und von einer Metaebene aus sollen sie ihrer Lenkungsaufgabe nachkommen, allerdings am Leitfaden von Mitarbeiter-Konstruktionen, denen praktisch das Primat, man kann fast sagen: ein höherer Wahrheitswert eingeräumt wird.
Repräsentativ dazu Dietrich von der Oelsnitz: „Damit wird die Persönlichkeit eines Managers (Hervorhebung im Original) zum wohl entscheidenden Parameter(….) Letztlich entscheiden die Geführten, ob ihr Chef intelligent wirkt oder eher schlau. Gebildet oder nur informiert. Interessiert oder neugierig. Ehrgeizig oder karrieregeil.“ Mit anderen Worten: Geführte urteilen über Führende. Ihr Urteile sind sakrosankt. Gleichzeitig gilt: Die Persönlichkeit des Führenden ist ausschlaggebend.
Den logischen Fehler in diesem Gedanken beiseite geschoben, sei das psychologische Moment angeleuchtet: Mitarbeitende konstruieren anhand ihres individuellen Erlebens jeweils eine Chef-Persönlichkeit. Nach Maßgabe ihres, der Mitarbeitenden, Urteils „wirkt“ die Chef-Persönlichkeit wie xy. Dieses „wirkt“ meint praktisch ein „ist“. Führende sind den Urteilen ausgesetzt, während umgekehrt „die Vorgesetzten lernen (müssen), dass sie nicht alles kontrollieren(…) können“ 150. Schon klar, nur: Was sollen Führende tun, wenn Mitarbeitende agieren, als seien ihre subjektiven Deutungen wahr? Was tun, wenn die konstruktivistische Schleife (unendlich) gezogen wird?
„Die Führungskraft des 21. Jahrhunderts kümmert sich in erster Linie um die Rahmenbedingungen der Arbeit und gestaltet sie so, dass persönliches Lernen angeregt und erleichtert wird.“ Das klingt gut! Aber, alas!, auch der Professor meint eingedenk einer Studie zu Burn-out von 2010: „Ein ungeeigneter Führungsstil (Hervorhebung im Original) hat seinen Platz in der Studie. Ein übermäßiges Misstrauen und/oder fehlender Respekt gegenüber den Mitarbeitern, aber auch intransparente Entscheidungen, eine lückenhafte Informationspolitik sowie unsachliche, bisweilen sogar persönlich ehrverletzende („übergriffige“) Kritik des Vorgesetzen sind wesentliche Steine des Anstoßes.“
Es sei nochmals betont: Logisch inkonsistent, aus konstruktivistischer Sicht nicht haltbar und psychologisch mindestens einseitig werden Wahrnehmungen, Empfindungen, Deutungen von Mitarbeitenden als Wahrheit genommen und zum Ausgangspunkt für Bewertungen und legitime Forderungen an Führende gemacht. Nicht gefragt wird beispielsweise, wer auf der Grundlage von was die Kriterien für „Übergriffigkeit“, „übermäßig“ oder „lückenhaft“ definiert. Oder wie „Transparenz“ (Durchsichtigkeit) verstanden wird.
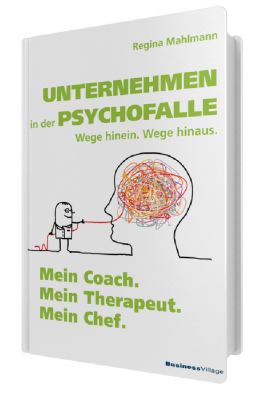
Führende werden zu Psychologisierung genötigt. Repräsentativ wieder Dietrich von der Oelsnitz: Auf die Frage, was Führende zu „guten Vorgesetzten“ macht, antwortet er: „Dass jemand, zum Beispiel, Karriere machen will oder seine Gehaltssituation verbessern möchte, ist ein häufig genanntes (…) Ziel. Ob es einen Menschen aufgrund seiner inneren Verfasstheit tatsächlich (Hervorhebung im Original) nach diesen Zielen verlangt, ist eine ganz andere Frage.“ Deshalb muss nachgebohrt werden – die psychoanalytische Figur. „Da man sich der eigenen Grundmotive aber eben häufig nicht bewusst ist, lohnt es sich, auf sein ,Bauchgefühl‘ zu hören.“ Aha, Bauchgefühl – das allerdings hängt von vergangenen Erfahrungen, Wissen und Können ab und ist keinesfalls per se hilfreich in neuen Kontexten, weder zur Klärung eigener Motive noch zur Klärung von Motiven anderer.
Systempsychologische Empfehlungen gehen darüber hinaus. Führende sollen auf das Ganze hin intervenieren. Sie sollen kommunikative und interaktive Routinen aufdecken, Korrelationen erkennen und durch Intervention so agieren, dass sie verwirren und dadurch Gewohnheiten stören. Typische Fragen: Welche subjektiven Deutungen, Annahmen, Überzeugungen konkurrieren? Wer hat welchen Einfluss auf wen? Welche Regeln gelten? Welche Kopplungen und Freiheitsgrade dominieren wo (feste, lockere)? Innerhalb welcher Situationen (Kontexte) hat was und wer auf wen welchen Einfluss?
Am Beispiel Motivation: Die Chefin des mindermotivierten Mitarbeiters muss nach subjektiven Deutungen der beteiligten Personen fragen, Interaktionsmuster und deren Geschichte unter die Lupe nehmen, Ausschau halten nach Ereignissen, Regeln, Kontexten, die ein engagiertes Verhalten be- oder verhindern. Sie muss ferner funktionale Fragen formulieren und nach funktionalen Äquivalenten spähen. Etwa: Welche Vorteile hat der Mitarbeiter durch sein Demotiviertsein? Welche „gute Absicht“ steckt dahinter? Zirkulär fragen soll die Chefin auch. Etwa: „Was, meinen Sie, wird ein Kollege einem anderen über Sie und das Ausmaß Ihres Engagements erzählen?“
Fazit: Psychologische Theorien und Modelle konkurrieren, werden miteinander verwurschtelt (Eklektizismus) und gebären praktische Konzepte, die von Führenden angewandt werden sollen. Sie sollen ihnen helfen, den psychologischen Anteil im Führen „gut“ zu machen. Bedauerlicherweise liefern sie keine Bremse und keine Kriterien für ein „Stopp“! Das gilt auch für die Anwendung eingesetzter Modelle.
Zu den bekanntesten Werkzeugen, weil in Führungstrainings seit Jahrzehnten eingesetzt, gehören Potenzialerfassungstools und Persönlichkeits-Typologien (häufig verschränkt) wie DISG, INSIGHTS, HBDI, MBTI, Reiss-Profile 155, die Anleihen machen bei Eignungs-, Anlage-, Charakterpsychologie ebenso wie bei Tiefen- und Humanistischer Psychologie. Lehr-Lern-Ansätze betonen das Lernen durch Vorbild, Loben und Tadeln (Verstärken) aus der kognitiven Verhaltenspsychologie. In der Gesprächsführung in der Tradition der Humanistischen Psychologie werden beschworen: Ich-Botschaften, Aktives Zuhören, Paraphrasieren, Verbalisieren von Gefühlen und Feedback, um die Verständigung auf emotionaler und sachlicher Ebene zu befördern. Die Transaktionsanalyse (Eltern-, Erwachsenen-, Kindheits-Ich) wird zudem zur Förderung von Selbsterkenntnis und Optimierung von Kommunikation eingesetzt. Die Psychologie der Persönlichkeitsentwicklung ist humanistisch und tiefenpsychologisch dominiert, in Führungsschulungen simplifiziert zu „Schrittfolgen“ zum „persönlichen Wachstum“, zu „Selbstführung“ bis zu Selbstsicherheits-, Selbstwertgefühlstraining, einschließlich „Arroganztraining für Frauen“ (Süddeutsche Zeitung Ende April/Anfang Mai 2012). Bei Fragen zur Führung von Einzelnen und Gruppen stehen Kataloge zum systemischen, zirkulären Fragen ebenso bereit wie Anleitungen für Imaginationsreisen (Systempsychologie, NLP (Neurolinguistisches Programmieren)), zuweilen angereichert um Frageformen und Geschichten aus der Salutogenese (Erforschen, was gesund hält und macht, anstatt zu bohren, was krank, unzufrieden macht), Copingforschung (Suche nach gesund und überlebensfähig haltenden Strategien) und Resilienz (siehe nächstes Kapitel „Auswege aus der Psychofalle“).
Der Unterschied zwischen Allgemeiner und Differentieller Psychologie ist eine andere Version, die Kirmes von Psychomodellen, das Karussell an Empfehlungen und den Schwindel auf der Anwenderseite herzuleiten.
Allgemeine Psychologie befasst sich mit dem Allgemeinmenschlichen. Logischerweise könnte sie Standards formulieren, die als Handreichung für praktische Orientierung dienen. Nicht als Rezepte, aber als Leitplanken. Dieses Unterfangen brachte innerhalb der Allgemeinen Psychologie verschiedene, mehr oder weniger miteinander harmonierende Strömungen hervor.

Dr. Regina Mahlmann, promovierte Soziologin und Philosophin, arbeitet als Coach, Beraterin und Referentin in und für Unternehmen – als Sparringpartnerin für das Topmanagement und als Impulsgeberin und Begleiterin von Gruppen, insbesondere in veränderungsreichen und daher spannungsreichen Phasen eines Unternehmens.

