Führungskräfte sind weder Erzieher noch Seelendoktoren. Sie sind Ergebnisverantwortliche in Wirtschaftsorganisationen. Mitarbeitende haben sich freiwillig und gegen Gehalt dazu verpflichtet, dabei zu helfen. Das aktuelle Missverständnis: Unternehmen und Führungskräfte seien dazu da, Mitarbeitende in ihrer Gesamtpersönlichkeit zu umsorgen und eine glückliche Lebensführung zu ermöglichen.
Die Burn-out-Welle hat die Pflicht an die Oberfläche gespült, mit der Führende traktiert werden: Mitarbeitende ganzheitlich zu umsorgen.
„Seit einigen Monaten läuft Mitarbeiterin X mit einem mürrischen Gesicht herum. Bereits zwei Mal habe ich sie gefragt, ob sie mit irgendetwas unzufrieden sei, ob ich oder ein anderer sie verletzt hätten und was ich tun könne, um ihr wieder mehr Freude an der Arbeit zu ermöglichen. Beide Male: keine Antwort. Nur ein mucksches Gesicht und Schweigen. – Ja, was soll ich denn noch machen?“
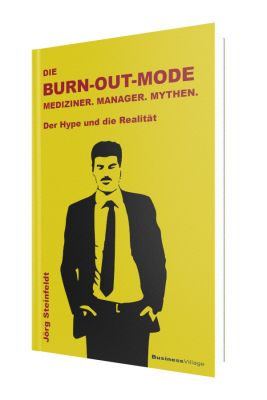
„Als es um die Frage nach Schulungen ging, wollte ein Mitarbeiter unbedingt einen Handauflege-Kurs buchen. Begründung: Freunde von ihm hätten den Kurs empfohlen, weil das Handauflegen beruhigende und heilende Wirkung entfalte und somit eine effektive Vorbeugung für Burn-out sei. Ich fragte, inwiefern er sich als Burn-out-gefährdet einstufe und was wir in der Arbeitsorganisation ändern könnten, um ihn zu entlasten. – Du meine Güte! Da hatte ich etwas gesagt! Ich musste mir dann anhören, meiner Fürsorgepflicht nicht nachzukommen, ihn auszubeuten, mich nicht für sein Wohlbefinden zu interessieren, obwohl er doch besser arbeite, wenn es ihm gut gehe und so weiter. – Sagen Sie, was ist eigentlich „ausbeuterisch“ daran, gemeinsam zu prüfen, ob man Prozesse etc. am Arbeitsplatz so ändern kann, dass ein Mitarbeiter weniger Druck verspürt?“
Erfundene Situationen? Mitnichten! In meinen über 20 Jahren Beratungspraxis versammeln sich weit dramatischere Fälle, die Ausdruck einer neueren Selbstverständlichkeit sind: Führende (bzw. Unternehmen) für persönliches Wohlbefinden einzuspannen – legitimiert durch Experten aus Medizin und Psychologie, flankiert von Personalern und Weiterbildnern.
Sie beladen Führungskräfte mit Psycho-Aufgaben, eingebettet in die ideologische Schablone von Tätern und Opfern und ein Menschenbild, das die Synergie von Seele, Leib, Geist und sozialem Umfeld und vom Menschen als Sinnsucher betont. Fazit: Führende müssen jedem Mitarbeiter psychophysischsoziales Wohlergehen und Sinnstiftung ermöglichen.
Warum sollten Führende die Delegation von Selbstfürsorge und Selbstverantwortung eigentlich annehmen?
Spätestens seit den 1970ern sickern psychologische Imperative in den Lebensalltag, prägen Denk- und Handlungsweisen, erzeugen Forderungen und marschieren über Angestellte in Unternehmen und ins Führungspflichtenheft hinein. Eine Folge: Führungskräfte führen nicht Mitarbeiter, sondern „ganze Menschen“ und müssen Selbstverwirklichung und Sinnstiftung gewährleisten. Führungsmodelle generieren paradoxale Anforderungen: Führende sollen „auf Augenhöhe“, psychologisch reflektiert und in quasitherapeutischer Manier handeln. Einerseits als Burn-out-Verursacher verunglimpft, werden die „Ausbeuter“ andererseits zu Rettern auserkoren.
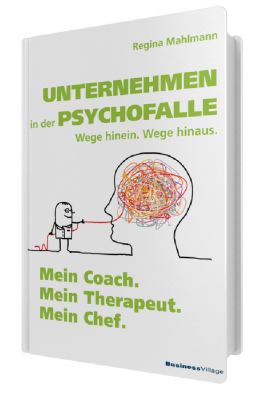
Die Zumutung, auf fachfremdem Gebiet zu agieren, nehmen zahlreiche Führende trotz der Nichtleistbarkeit an. Der Preis: Dilemmata, aus denen sie kaum herauskommen, ohne an Selbstzweifeln zu leiden oder mit dem Vorwurf der Unfähigkeit, Kaltherzigkeit, des Narzissmus zugedeckt zu werden.
Als Ausweg liegen zwei Optionen nahe: die Konzentration auf Verhalten und Folgen und die Beschränkung auf die berufliche Rolle.
Die erste Option verbindet Pragmatismus und verhaltensökonomische Erkenntnisse. Akteure konzentrieren sich auf das Offenkundige und verzichten darauf, Befindlichkeiten und Innerseelisches aus Mimik, Gestik etc. „herauszulesen“.
Die zweite Option legt den Fokus auf den verbindlichen Kern an wechselseitigen Pflichten und Rechten, an legitimen Erwartungen und Themen. Beispiel: Verlangt eine Führungskraft, dass Mitarbeitende in der Kinderbetreuung assistieren oder drückt sie sich grundsätzlich davor, bei Teamkonflikten einzuschreiten, ist das genauso illegitim wie das Verlangen eines Mitarbeiters, die Führungskraft solle bei familiären Konflikten intervenieren oder ihn nicht mit Routineaufgaben behelligen, weil dies seine kreative Lebensenergie abwürge.
Fazit: Psychologisiertes Führen im Sinn des „Pamperns“ ist weder ein unerlässliches Gebot noch alternativlos.

Dr. Regina Mahlmann, promovierte Soziologin und Philosophin, arbeitet als Coach, Beraterin und Referentin in und für Unternehmen – als Sparringpartnerin für das Topmanagement und als Impulsgeberin und Begleiterin von Gruppen, insbesondere in veränderungsreichen und daher spannungsreichen Phasen eines Unternehmens.

