Wenn Sie sich mal einen Blick in die sozialen Netzwerke gönnen, da vergeht nicht ein Tag, an dem nicht irgendwer diese Aussage bei Facebook, Twitter & Co massentauglich verbreitet. Und wenn dann auch noch »erwachsene« Menschen mit »Ja richtig, gar nichts muss ich. Ich bin ein total freier Mensch!«, »Genauso ist es, ich muss höchstens irgendwann mal sterben oder anständig aufs Klo!« kommentieren kann einem Angst und Bange werden. Denn der Glaube »nichts zu müssen« ist einer der gravierensten Missverständnisse der Gegenwart.
Das, was für mich inhaltlich und intellektuell dahintersteckt, ist doch etwas ganz anderes. Es bedeutet, dass wir immer die Wahl haben, eine Alternative, eine Option. Wenn Sie an eine Weggabelung kommen, haben Sie vier Optionen: links, rechts, zurück oder stehen bleiben. Genau das steckt als Botschaft in dem Satz »Ich muss erst mal gar nichts«. Die Auswahl, die Option, die Freiheit der Entscheidung. Was die Menschen aber daraus machen, ist, ich brauche mich nicht mehr anstrengen, nicht mehr durchhalten, kann einfach aufgeben, wenn es unbequem wird, es hinschmeißen.
Der Glaube daran, dass wir nichts müssen, ist eines der gravierendsten Missverständnisse der Gegenwart. Unzählige persönliche Probleme, gesellschaftliche Entwicklungen und ungelöste Aufgaben hängen damit zusammen. Mangelnde Selbstregulation hat sich wahrhaft zu einem der größten Probleme unserer Zeit entwickelt.
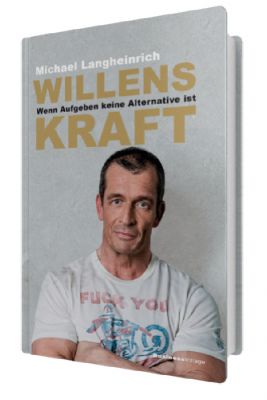
Dieser Glaube, der mangelnde Selbstbeherrschung toleriert, zeigt überall in der Gesellschaft seine Fratze zum Beispiel in zwanghaftem Konsumverhalten (Kaufrausch), das nicht selten in der Überschuldung endet, Gewaltexzessen, Übergewicht, …
Doch Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin sind die Schlüsselkompetenzen und wichtiger als der Intelligenzquotient. Dieses belegen Studien eindeutig. Je weniger impulsiv und je selbstkontrollierter die Dreizehn- bis Vierzehnjährigen nach Berichten ihrer Eltern und Lehrer sowie nach den Ergebnissen einiger psychologischer Tests dabei waren, desto besser schnitten sie im nächsten Halbjahr bei den schulischen Leistungen ab. Im Umkehrschluss hatten selbst intelligente, aber weniger disziplinierte Jugendliche mehr Schwierigkeiten mit dem Lernstoff. Analog können wir dieses Zusammenspiel von Selbstdisziplin und Produktivität im Erwachsenenleben am Arbeitsplatz beobachten.
Die Alt-68er-Philosiophie, dass alles, was sich gut anfühlt auch gut ist, reicht eben nicht aus, um unsere Ideen und Wünsche auf die Zielgerade zu bringen. Müssen ist daher lediglich ein neutrales Wort für ein Erfordernis. Es ist kein Synonym für Zwang. Also entspannen Sie sich, wenn das nächste Mal jemand zu Ihnen sagt, Sie müssten noch dieses oder jenes tun, und antworten Sie nicht gleich: »Einen Scheiß muss ich.«
Keine Erwartungen, keine Enttäuschungen
Kommt Ihnen das bekannt vor? Welch herrlicher Quatsch. Was für eine hohle Phrase. Viele Menschen glauben, dass nur unsere Erwartungen maßgeblich für unsere Enttäuschungen verantwortlich sind und wir uns Enttäuschungen dadurch ersparen könnten, indem wir weniger oder nichts von anderen oder dem Leben erwarten.
Manche Enttäuschungen kann man sicherlich vermeiden, indem man aus vergangenen Fehleinschätzungen und Erfahrungen lernt und überhöhte Erwartungen vermeidet.
Generell können wir Enttäuschungen jedoch nicht aus dem Weg gehen. Nach meiner Erfahrung wirkt sich eine solche Haltung auch hinderlich und störend auf unseren Elan, unsere Lebensfreude und auf die Beziehung zu anderen Menschen aus.
Wenn eine Fußballmannschaft in ein Spiel geht, dann bereiten sich die Spieler im Training so zielgerichtet vor, dass jeder Spieler erwarten wird, dieses Spiel auch zu gewinnen. Alles andere wäre doch Unsinn. Dass nach einer dann entgegen diesen Erwartungen eingetretenen Niederlage die Enttäuschung da ist, gehört einfach dazu. Denn nur so haben die Spieler die Chance zu wachsen, sich zu verbessern und es bei den nächsten Trainingseinheiten und der nächsten Begegnung besser zu machen.
Eine positive Erwartungshaltung motiviert also in der Regel und erzeugt auch Vorfreude. Eine positive Erwartungshaltung trägt maßgeblich zum Genuss und Erfolg dessen bei, was wir erwarten – wenn das gewünschte Ergebnis eintritt. Wer nichts Positives erwartet, beraubt sich dieser Vorfreude und damit vieler genussvoller und schöner Momente. Außerdem sind wir auf unsere Vorhersagen angewiesen.
Kann positives Denken eine Strategie sein?
Ist es sinnvoll, immer positiv zu denken und niemals am Erfolg zu zweifeln? Sind langfristig Positivdenker erfolgreicher als notorische Pessimisten? Vielleicht im Hochleistungssport oder in einzelnen Extremsituationen. Einverstanden. Aber ist positives Denken per se alltagstauglich? Hilft mir das bei Krankheit, Trauer, Armut oder Überlastung?
Sie müssen nur fest an Ihren Erfolg glauben, so steht es doch in den meisten Selbstoptimierungsbüchern, beginnend von Napoleon Hill und Dale Carnegie über Brian Tracy bis hin zu aktuellen Werken von Bodo Schäfer.
Dennoch hadern Menschen mit ihren guten Vorsätzen und Wünschen und verlieren langfristige Ziele schon mal aus dem Fokus. Was uns klassische Motivationstrainer, Selbstoptimierer und Erfolgsgurus gerne verschweigen, ist die Tatsache, dass nicht immer alles klappt, oft sogar gar nichts, und vielleicht gibt es auch Konstellationen, wo das ganze Ziel oder die gewählte Strategie einfach falsch ist. Der Mensch kann bekanntlich irren. Vielleicht fehlen daher manchmal schlichtweg nur die körperlichen Voraussetzungen, die mentale Stärke oder auch die Disziplin und Willenskraft für einen bestimmten, erwünschten Erfolg.
Immer wieder wird selbst in Schwierigen Situationen von Trainern und Coaches geraten, positiv zu denken. Ein empirischer Nachweis das diese Methode funktioniert, ist mir nicht bekannt.
Die amerikanische Autorin Barbara Ehrenreich setzt sich sehr vehement und kritisch mit diesem Denken auseinander. In ihrem Buch Smile or Die. Wie die Ideologie des positiven Denkens die Welt verdummt bezeichnet sie das positive Denken als Ideologie und Virus. Sie kritisiert die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem, die Wirtschaft und das Finanzsystem und macht zum Beispiel für die Wirtschaftskrise einen typischen Realitätsverlust durch positives Denken verantwortlich.
Wer ausschließlich positiv denkt, geht Risiken im Leben ein, deren Eintreten ihn für Jahre oder gar für immer unglücklich machen kann. Das zwanghaft aufgesetzte positive Denken ist eine Verdrängungs- und Schmalspur-Psychologie, ein reines Schwarz-Weiß-Denken.
Abgesehen davon, dass ein Mensch nicht immer nur positiv denken kann, sind negative Gedanken und Gefühle für die Psychohygiene und die Orientierung in der Welt mindestens genauso wichtig wie positive. Negative Gedanken und Gefühle tragen dazu bei, schlechte Erlebnisse, Traumata und die unweigerlichen Schattenseiten, unliebsame Herausforderungen des Lebens, zu bewältigen. Sollten wir deshalb das positive Denken aufgeben? Nein, das natürlich auch nicht. Positives Denken kann für viele Menschen und in vielen Situationen nützlich und förderlich sein.
Gleichzeitig kann übertriebenes positives Denken aber auch absolut kontraproduktiv sein, wenn es dazu dient, tiefer liegende Probleme zu leugnen, anstatt wirklich anzugehen.
Optimismus, Träume und Wünsche sind wichtig. Allerdings sollten wir absolut ehrlich zu uns selbst sein und herausfinden, was unsere inneren und äußeren Handlungsbarrieren sind, welche Hindernisse und Schwierigkeiten einzuplanen sind, um unsere Wünsche zu erfüllen, unsere Ideen umzusetzen und unsere Ziele zu erreichen.
Also: Wie wäre es denn, selbst die Verantwortung für das, was passiert – und eben auch für das, was nicht passiert –, zu übernehmen? Denn das meiste um Sie herum passiert, weil Sie sich entscheiden oder eben eine Entscheidung vermeiden.

