Pro Sekunde prasseln so 100 MB Daten auf Ihr Gehirn ein. Das ist ein ernormes Datenvolumen, das da verarbeitet werden muss – bzw. teilweise auch gleich dem „Papierkorb“ zugeführt wird. Übetragen auf die Kommunikation bedeutet das, dass Ihr Gesprächspartner nur einen Teil bewusst verarbeiten kann. Deshalb ist es umso wichitger, sich auf das Relevante zu beschränken … Viel reden war gestern …
Dein Auge sendet pro Sekunde mindestens zehn Millionen Bit Information an dein Gehirn. Deine Haut übermittelt ebenfalls rund eine Million Bit. Dein Hör- und dein Geruchssinn steuern jeweils 100.000 Bit bei. Und als Draufgabe liefert dein Geschmacksinn auch noch mal circa 1.000 Bit. Zusammengezählt kommen wir damit auf mehr als elf Millionen Bit/Sekunde, die an dein Gehirn weitergeleitet werden. Eine ordentliche Menge! Jetzt das entscheidende, große Aber. Bewusst kannst du nur einen Bruchteil der erhaltenen Information aufnehmen und verarbeiten – nämlich gerade einmal um die 10 bis 15 Bit/Sekunde. Das ist, grob formuliert, ein Millionstel dessen, was du in der gleichen Zeit über deine verschiedenen Sinne wahrnimmst. Zusätzlich ist es von Bedeutung zu wissen, dass es neben dieser Limitierung auch noch eine sogenannte ›Gegenwartsdauer‹ gibt.
Schreibe in beliebiger Reihenfolge zwölf Zahlen (zwischen 0 und 9) auf einen Zettel, zum Beispiel 8 6 4 2 7 3 1 6 5 7 6 7.
Dann lese diese Zahlen jemandem ein einziges Mal vor und bitte ihn vorab, sich die Zahlen und deren Reihenfolge zu merken. Du siehst anschließend, dass die Person maximal fünf bis acht der Zahlen in richtiger Reihenfolge wiedergeben kann. Warum ist das so? Eine Zahl entspricht ungefähr einer Informationseinheit von 15 Bit. Wunderbar – das sollte sich ausgehen: eine Zahl pro Sekunde. Jetzt ist allerdings die Gegenwartsdauer bei uns Menschen dummerweise auf sechs Sekunden begrenzt. Das heißt, du kannst sechs Informationen ›stapeln‹ – dir also merken. Danach fallen die zuerst wahrgenommenen Informationen/Zahlen wieder aus deinem Kurzzeitgedächtnis heraus und werden in dein Langzeitgedächtnis abgelegt. Dieses Abspeichern wiederum bedarf bewusster ›Ablage‹, zum Beispiel durch Wiederholung. Und während du das tust, kannst du logischerweise nicht mehr zuhören und die letzten Zahlen im Kurzzeitgedächtnis speichern.
Umgelegt auf deine Kommunikation bedeutet das, dass du dir immer im Klaren sein musst, dass dein Gesprächspartner nur eine gewisse Menge an Information bewusst verarbeiten kann. Sendest du zu viel Information auf einmal, gehen Inhalte verloren – du verlierst die Aufmerksamkeit und das Verständnis des anderen. Deine Teilnehmer schlafen bei Präsentationen ein. Du erschlägst als Verkäufer deinen Kunden mit Information. Dein Mitarbeiter oder Kind versteht die von dir gestellten Aufgaben nicht, weil sie dir nicht mehr folgen können.
Kurze Sätze
In der Theorie sind Sätze mit durchschnittlich sechs bis acht Wörtern zu empfehlen (achte einmal auf die Länge von Werbeslogans). Dies ist in der gesprochenen Sprache natürlich nicht immer möglich. Entscheidend ist jetzt allerdings auch nicht, ob deine Sätze sechs, acht oder zwölf Wörter haben, sondern vielmehr, dass du darauf achtest, kurze Sätze zu benutzen. Vermeide, wo immer du kannst, Satzungetüme und übe, deine Inhalte und Informationen kürzer und prägnanter zu formulieren. Sprich, wo immer es dir möglich ist, in kurzen Hauptsätzen: Dein Zuhörer versteht dich besser. Er kann dir schneller folgen. Du sprichst automatisch langsamer. Du hast mehr Zeit zum Nachdenken. Du versprichst dich seltener. Kurzum: Deine Kommunikation ist effizienter und effektiver!
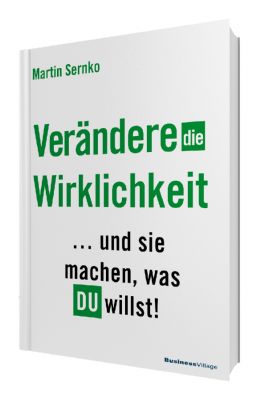
Anbei ein ›kleines‹ Satzbeispiel von Angela Merkel aus der Präsidentschaftswahldebatte 2009. Wie lange, glaubst du, haben die interessierten Zuhörer ihren Ausführungen gedanklich folgen können?
»Nein, also ich bin mitten im Wahlkampf, ich kämpfe um jede Stimme und ich glaube, wir können das schaffen und das, was Sie machen, Herr Steinmeier, das ist ja nur, dass Sie auf der einen Seite die Koalition der Union mit der FDP als sozusagen das Schreckgespenst per se darstellen, aber auf der andern Seite ja angeblich auch mit den Liberalen gerne in eine Koalition gehen wollen und da muss ich einfach sagen, das verstehen die Menschen nicht und das ist das Problem der SPD insgesamt, dass sie nicht so richtig weiß, wo sie hin soll, soll sie die Erfolge der großen Koalition loben, wie Sie das tun, soll man dagegen anrennen, wie andere das tun, wenn Herr Heil sagt Höchststrafe, und diese Zerrissenheit ist es, von der ich sage, das ergibt keine stabilen Verhältnisse und deshalb glaube – bin ich ganz gewiss, dass wir das schaffen können, aber bei der großen Ernsthaftigkeit um jeder einzelnen Stimme.«
Pausen, Pausen, Pausen
Viele Menschen reden ohne Punkt und Komma. Die Sätze werden länger und länger. Es fällt anderen zunehmend schwer, dem Gesagten inhaltlich zu folgen. Die meisten Leute haben schlicht und einfach Angst vor Pausen. Und ein gesetzter Punkt am Ende eines Satzes bewirkt nun einmal eine Pause. Bewusst gesetzte Pausen sind in der Rhetorik nicht nur in Ordnung, sondern bieten dir eine große Menge an Vorteilen: Du erhöhst die Aufmerksamkeit und stellst sicher, dass das Verständnis sich verbessert. Du gewinnst Zeit, um vorzudenken, und kannst in Ruhe Höhepunkte einleiten. Insgesamt wirkst du durch bewusste Pausensetzung weniger hektisch und reduzierst ganz nebenbei Versprecher und verhinderst inhaltliche Fehler.
Die leidigen Füllwörter
Wie gesagt: Ohne sinnvollen Grund haben die meisten Redner höllische Angst vor Pausen. Da sie hierdurch reden und reden und vor lauter reden nicht mehr dazu kommen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich sagen wollen, passiert meist Folgendes: Füllwörter werden benutzt, um zwei Sätze zu verbinden: ›Äh!‹, ›Ähm!‹, ›Und‹, ›Also‹, ›Tja!‹, ›Gut!‹, ›Okay!‹ …
Ein hie und da gesetztes ›Äh!‹ oder Ähnliches ist in Ordnung und kein rhetorischer Beinbruch. Dein Zuhörer oder Publikum bekommt es meistens gar nicht bewusst mit. Benutzt du allerdings gewisse Füllwörter immer und immer wieder, wirkt dies irritierend und störend. Die Kompetenz, die andere an dir wahrnehmen, nähert sich dem Nullpunkt.
Der deutsche Politiker Edmund Stoiber ist bekannt für das Füllwort ›Äh!‹. Durch das Üben, kürzere Sätze zu benutzen, würde er sicher mehr Zeit für seine Gedankengänge gewinnen und die Anzahl der ›Ähs!‹ deutlich verringern. Hier einige Auszüge aus einem Gespräch bei Sabine Christiansen 2002: »Erstens: Es muss – äh – zum Beispiel bei vier Millionen Arbeitslosen in Deutschland – generell den Anwerbestopp für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb der Europäischen Union aufzuheben, halte ich für falsch, das kann man den Millionen von Arbeitslosen in Deutschland nicht – äh – deutlich machen, hier stimme ich sogar ausnahmsweise mal mit Oskar Lafontaine überein, der das – äh – äh – am Sonntag vor einer Woche hier auch so deutlich gemacht hat. – Äh – zweiter Punkt: Ich halte also die Begren – ich halte den Anwerbestopp – der muss – äh – kann nicht generell aufgehoben werden. … Ob wir dann im langfrist – äh – die Dinge wieder verändern, da muss ich Ihnen ganz offen sagen, äh – da müssen wir – äh – in Ruhe – äh – die Dinge in – erörtern und behandeln. […] Und jetzt – das ist unsere Position, nie haben wir etwas anderes gesagt – wenn wir im September die Mehrheit bekommen, dann kann ich nur sagen – und deckungsgleich – äh – Herr Merz – äh – äh – Frau – äh – äh – Frau Merkel oder ich oder wer auch immer, das ist die Position von CDU/CSU […] Es gibt doch keinen Flop. – Äh – ich meine, man überlegt, das hat – äh – äh – verschiedene Aspekte, ich hab mit Frau Merkel darüber gesprochen, und – äh – das war noch überhaupt nicht konkret, wir haben – äh – überlegt, wie – äh – ordnen wir eigentlich die Wahlkampfstruktur zu …«
Das einfache Darauflosreden, ohne darüber nachzudenken, was man eigentlich sagen will, mindert die Überzeugungskraft und Logik des zum Ausdruck Gebrachten beträchtlich. Stichwort: Betrunkene oder kleine Kinder. Natürlich kannst du dich nicht auf jede Gesprächssituation hundertprozentig vorbereiten – das ist klar! Setze deswegen Pausen, während du sprichst. Dein Gesprächspartner dankt es dir und du gewinnst wertvolle Zeit um Vorgehen, Argumentationen und Formulierungen zu planen.
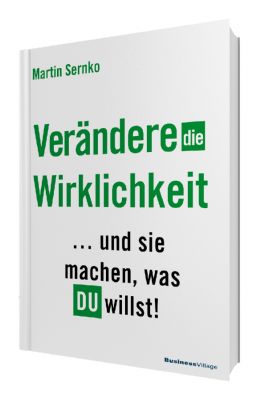
Ein weiterer Grund für Pausen, kurze Sätze und langsameres Sprechen: Man weiß heute, dass die Denkgeschwindigkeit schneller ist als die Sprechgeschwindigkeit. Zehn- bis fünfzehn Mal! Während du sprichst, fällt dir alles Mögliche ein und, obwohl du erst dabei bist, den alten Gedanken auszuführen, bindest du schon neue Information in das Gesagte ein. Deine Sätze werden länger und komplizierter. Es ist zunehmend schwierig, deinen Ausführungen zu folgen.
Hör mir zu! – Wie du Ankünder richtig einsetzt
Die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs beträgt nach Untersuchungen (ja, die gibt es!) gerade einmal drei Sekunden. Zugegeben, wir Menschen haben da ein größeres Potenzial und doch ist es oft ein Ding der Unmöglichkeit sicherzustellen, dass dein Gesprächspartner oder dein Publikum längerfristig seine Konzentration auf das von dir Gesagte richtet. Der oder die Zuhörer verlieren sich in eigenen Gedanken oder schalten zwischendurch komplett ab. Sie befinden sich nur noch im Stand-by-Modus. Gerade bei langen Gesprächen, Diskussionen oder Vorträgen liegt es in der Natur der Sache, dass solche unliebsamen Reaktionen eintreten. Je länger die Aufmerksamkeit aufrecht gehalten werden muss, desto schneller und öfter verlieren sich andere in eigenen Gedanken oder erliegen der Versuchung verschiedenster Ablenkungen. Ein guter Redner oder Trainer weiß dies und benutzt verschiedene Techniken, um sein Publikum von Zeit zu Zeit wieder zurückzuholen und dessen Interesse an dem von ihm Gesagten neu zu entfachen. Benutze daher die folgende Vorgangsweise immer dann, wenn du die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners sicherstellen und dessen Interesse wecken willst.
Erwartungen wecken und nutzen
Aufmerksamkeit wird von Erwartungen gesteuert. Erwartet dein Gesprächspartner, dass du in Kürze eine für ihn wertvolle Information sendest, hört er dir mit geschärften Sinnen zu. Das ist wie beim Fernsehen. In der Werbepause schaltest du geistig ab. Kommt die Einblendung ›Noch zehn Sekunden – dann geht’s weiter!‹, richtest du deine Augen wieder konzentriert auf den Bildschirm. Umgelegt auf die Rhetorik bedeutet dies, dass du positive, zeitnahe Erwartungen durch Worte aufbaust.
»Nadja, meine Tochter, ich sage dir jetzt etwas wirklich Wichtiges!«
Der Ankünder ist der Ausdruck ›etwas Wichtiges‹. Verstärkt wird dieser durch das Wort ›wirklich‹. Rhetorische Verstärker vervielfachen die Kraft eines Ankünders oder Eigenschafsworts im Generellen.
| wirklich | unglaublich | absolut |
| besonders | ganz und gar | ganz |
| richtig | ehrlich | wahrhaft |
| außerordentlich | einzigartig | enorm |
| hoch | etc. |
Benutze Verstärker-Ankünder-Kombinationen überlegt. Wenn du Erwartungen weckst, tust du gut daran, diese auch zumindest im Ansatz zu erfüllen.
»Lieber Herr Marxer, für den Schluss habe ich mir das Beste aufgehoben. Unser neues, unglaubliches Angebot für Erstkäufer. Wenn sie den Kombi um 24.990 Euro kaufen, bekommen Sie nicht nur zwei, sondern drei kostenlose Fußmatten dazu!«
Achte zusätzlich stets darauf, es mit dem Einsatz nicht zu übertreiben. Sonst wirkst du bald unglaubwürdig und die Wirkung der Technik verpufft.
»Nadja, meine Tochter, ich sage dir jetzt etwas wirklich Wichtiges!« … »Und was auch noch enorm wichtig ist … Aber eigentlich am absolut wichtigsten ist … Und ehrlich, noch wichtiger …«

Mag. Martin Sernko zählt zu den führenden Kommunikationsexperten Europas. Bekannt für seinen eigenen, unverwechselbaren Stil – geprägt von hoher Dynamik, Innovation und Motivation –, steht er dafür, Altbekanntes stets kritisch zu durchleuchten sowie gänzlich neue Ansätze und Techniken zu entwickeln.

